Anhang 4: JUDEN UND CHRISTEN
Heilige Schriften und irdische Machtphantasien
Mythos und Gesetz
Antikes Judentum bis zum Ende des Tempels
Von Jesus zu Paulus
Der Jesus der Evangelien
Die Seele und ihre Erlösung (Erlösung / Das Wirkliche, Eigentliche und der Tod)
Der verlorene Sohn
Anfangen bei Adam und Eva, beim jüdischen Mythos, bei biblischen Geschichten? Was sonst. Die hellenistische Antike hatte zwar jenseits des Judentums und der sich ins Christentum entwickelten Jesus-Gemeinden eine eigene Tendenz, ihre ursprünglich auf der Verehrung von Naturgewalten basierenden Kulte durch einen Ein-Gott-Glauben bzw. das Eine (hen) der zu ersetzen, aber es setzte sich eben kein Mithras, Serapis oder Sonnengott durch, sondern jener dem Judentum entsprungene Messias/Christus als Gottessohn und mit ihm ein Gott, dem die Welt, die er schafft, nach der Schöpfung äußerlich bleibt, und der im christlichen Heilsmythos diese zunächst durch die Wiederkunft seines Sohnes heimholen möchte, dann aber, nach Ausbleiben dieses eschatologischen Heilsgeschehens, ein irdisches Heilsgeschehen durch seine Kirche verwalten lässt.
1. Heilige Schriften und irdische Machtphantasien
Das christliche Abendland hat drei offensichtliche Wurzeln, die sich in etwa gleichzeitig entfalten: Die Texte der griechischen Poliskultur, die römische Reichsbildung und Zivilisation und die heiligen Schriften der Juden.
Letztere immerhin erreichten mehr als eine kleine Gruppe von Belesenen und verankerten sich tief in der Sprache und Bildersprache so ziemlich aller, und zwar in ihrer „christlichen“ Ausdeutung. Wer sich mit abendländischer Malerei, Plastik und Literatur zwischen Christianisierung und industrieller „Revolution“ beschäftigen möchte, ist (immer noch) auf die Kenntnis vieler heiliger Schriften der Juden (und Christen) angewiesen. Der Verlust dieser Kenntnis im zwanzigsten Jahrhundert (zusammen mit dem Verlust von „Geschichte“ und der Kenntnis des Lateinischen und Altgriechischen der wenigen) ist ein ähnlich gravierender Bruch wie ihn der Massenkonsum von Industrieprodukten, die fast völlige Entkoppelung von Geschlechtlichkeit und Fortpflanzung und die Gleichschaltung der Köpfe durch die elektronischen Massenmedien zur selben Zeit bei der Masse der Menschen darstellen.
Die zwei unübersehbaren Besonderheiten der jüdischen Schriftreligion sind der besondere Monotheismus und eine dazu gehörige eigenartige Vorstellung von „völkischer“ Geschichte, die auf einer besonderen Form der Auserwähltheit beruht und nicht nur auf der Gewalt von Waffen und der Macht dynastischer Interessen.
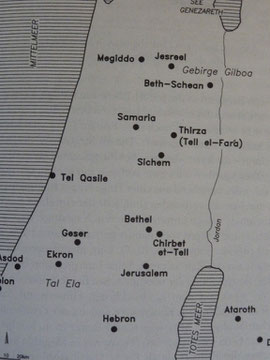
Mit Hilfe der Archäologie lässt sich inzwischen diese Geschichte in einen bewusst fabrizierten Mythos und eine ansatzweise nachvollziehbare Geschichte zweier kleiner „Reiche“ aufteilen. Jede Vorgeschichte dieser beiden Reiche entzieht sich unserer genaueren Kenntnis mangels schriftlicher Quellen. Sie handelt von kleinen dörflichen Siedlungen im Bergland zwischen Jordan und der Ebene zum Mittelmeer, in ersten Wellen in der Bronzezeit besiedelt, mit einem neuen, stärkeren Besiedlungsschub in der frühen Eisenzeit, nach dem Untergang der bronzezeitlichen städtischen und Palastkulturen, für die zum Beispiel Mykene steht oder Megiddo.
Der Norden war fruchtbarer als der Süden, ansonsten scheint es eine ähnliche Mischung aus Gartenbau (Oliven, Wein), Getreideanbau und Viehzucht gegeben zu haben. Schon früh scheinen sich zwei Zentren herausgebildet zu haben: Im Norden in der Nähe des späteren Sichem, im Süden in der Nähe von Jerusalem.
Wenn man Finkelstein/Silberman folgt, gibt es als erkennbare Gemeinsamkeit noch den Verzicht auf Schweinezucht und Verzehr von Schweinefleisch. Zu vermuten ist, dass sich in dieser frühen Eisenzeit zudem eine gemeinsame Sprache entwickelt, das Hebräische, welches sich vom ebenfalls semitischen Aramäischen nördlich davon und westlich vom Phönizischen absetzte.
Der Norden entwickelt im neunten Jahrhundert ein "Königreich" Israel mit steinernen Palastbauten vor allem in Megiddo, Jesreel und Samaria, mit einer entwickelten Verwaltung, ausgeprägter Oberschicht und einer Überschussproduktion für Handel und Luxus.
Der Süden, später Juda genannt, bleibt bei Subsistenzwirtschaft ohne ausgeprägte städtische Siedlungen. Die archäologisch nicht nachweisbaren mythischen Könige Saul, David und Salomo waren, so es sie überhaupt gab, eine Art einfache Stammeshäuptlinge in dörflichen Siedlungen – ohne Palastanlagen und städtische Zentren.
Das Königreich Israel schafft es nach 880 unter der Dynastie der Omriden, sich erheblich auszudehnen, und beherrscht schließlich dank militärischer Überlegenheit ein Gebiet zwischen der Gegend um Damaskus bis an die Ränder Judas. Es ist ein typischer orientalischer Vielvölkerstaat und eine klassische Despotie, neben den Hebräern gibt es Aramäer im Norden, Phönizier im Westen und semitische Nachbarn wie die Moabiter im Süden. Die Archäologie gibt keine spezifisch hebräisch geprägte Kultur her.
Das Abendland wird später aber nicht von verifizierbarer israelitischer Geschichte geprägt werden, sondern von judäischen Texten des 7. bis 5. Jahrhundert, die nach dem Untergang des Königreiches Israel geschrieben werden. Diese konzipieren das sagenhafte Gesamtreich aller Jahwe-getreuen Hebräer mit David und Salomo, auf das sich die Könige und Kaiser zwischen Konstantin und dem Hochmittelalter beziehen werden. Von diesem fällt laut heiliger Schriften das omridische Königreich Israel ab und verfällt zugleich der Sünde der Abkehr von Jahwe. In die Erinnerung des christlichen Abendlandes gerät vor allem König Ahab, Sohn Omris, der „tat, was dem Herrn missfiel“. Er heiratete nämlich eine phönizische Prinzessin, die in den Augen der viel späteren judäischen Autoren böse Jezebel, die Baal und Aschera opfert. Kein Wunder, dass dieses böse Israel (das mächtige Nordreich) irgendwann untergehen wird.
Historisches taucht dann zum Untergang von Israel im 'Buch der Könige' auf. Zunächst erobert das Reich von Aram/Damaskus große nördliche Teile. Kultur und Sprache dort sind offensichtlich aramäisch. Danach gewinnt Israel neue Macht und weiteren Wohlstand. Die ersten hebräischen Inschriften sind aus dieser Zeit (und nur von dort) überliefert.
Möglicherweise jetzt entsteht mit den Propheten eine neue Art literarischer hebräischer Schriften. Amos und Hosea sind zwar durch die judäischen Redaktionen gegangen, aber ihr Ursprung könnte in der Blütezeit des Königreiches Israel liegen, in der sie Ausbeutung, Armut, Götzendienst und „Hurerei“ anprangern. Amos verbindet die Abkehr vom jüdischen Gott mit Parteinahme für die Armen. In der Elberfelder Ausgabe von 1986 klingt das so:
Weil ihr vom Geringen Pachtzinsen erhebt und und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut … Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt... Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite (Amos 5, 10-13)
Sie liegen auf Elfenbeilagern und räkeln sich auf ihren Ruhebetten. Sie essen Fettschafe von der Herde und Kälber aus dem Maststall. Sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David Musikinstrumente aus. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen, aber über den Zusammenbruch Josephs sind sie nicht bekümmert. (Amos 6, 4-6)
"Die Kritik des Amos, der zufolge die Landbevölkerung von einer reichen Elite ausgebeutet wurde, steht im Kontext einer wirtschaftlichen Entwicklung, bei der das alte Modell einer Subsistenzwirtschaft durch eine Art Rentenkapitalismus ersetzt wurde." (Schipper, S.46; das Wort Kapitalismus ist allerdings überzogen).
Ähnlich wie Amos (Das Ende für mein Volk Israel ist gekommen) wird auch Hosea das Ende des Königreichs verkünden:
Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Gott. Sie werden durchs Schwert fallen, ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. (Hosea 14)
Hosea legt aber das Schwergewicht auf zwei andere Aspekte, nämlich die Sexualgebote, wie sie dann in Moses formuliert werden, und auf das Thema des Rechts und der Gerechtigkeit. Da heißt es zum Beispiel:
Denn der HERR hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes; denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet, und Bluttat reiht sich an Bluttat. (Hosea 4, 1+2)
Das durchgehende Thema ist aber das der „Hurerei“. Da ist einmal der Bruch der familiär formulierten Beziehung Gottes zu seinem Volk, gehurt wird in übertragendem Sinne durch die Verehrung von „Götzenbildern“ wie denen des Baal oder beim Opfern auf kanaanäischen Höhenheiligtümern, wörtlich in der Tempelprostitution, beim Ehebruch und – ganz besonders schlimm – beim Koitus mit Nichthebräern bzw. Ungläubigen: sie haben fremde Kinder gezeugt (Hosea 5,7), Ephraim vermischt sich mit den Völkern (Hosea 7,8) Du hurst weg von deinem Gott, du liebst Dirnenlohn auf allen Korntennen (Hosea 9,2); in der Folge wird das Volk Gottes aussterben: Kein Gebären, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis (Hosea 9,11)
Rechtlichkeit und Gerechtigkeit, Solidarität untereinander und besonders mit den eigenen Armen, schließlich eine zugleich religiös und völkisch begründete archaische Vorform von Rassismus weisen hin zu den sogenannten mosaischen Gesetzen.
Schließlich steigt Assyrien auf, besetzt zunächst den Norden und deportiert Teile der dortigen Bevölkerung. Im Verlauf des 8. Jahrhunderts wird Israel immer mehr auf das Bergland um Samaria reduziert, und 722 nimmt Salmanassar auch Samaria ein:
und führte Israel weg nach Assyrien. Stattdessen siedelt er dort Leute aus dem Zweistromland an: und ließen sie wohnen in den Städten von Samaria an Israels statt. (beides 2 Könige, 17.6)
Assyrien zerstört die israelitische Stadtlandschaft vollständig und siedelt nach der Deportation eines großen Teils der Bevölkerung in assyrische Reichsteile Assyrer im nun untergegangenen Israel an.
Ich bevölkerte Samaria mehr als zuvor. Ich brachte Völker aus Ländern, die ich mit meinen Händen erobert habe, hinein. Ich setzte meinen Beauftragten als Gouverneur über sie. Und ich zählte sie zu den Assyrern, lässt Sargon aufschreiben (In Finkelstein/Silberman, S.240)
Eine eigenständige schriftliche Geschichte Israels hat seinen völligen Untergang nicht überlebt, was einmal an der Vernichtung seiner intellektuellen Eliten gelegen haben mag, zum anderen aber vielleicht auch an der Redaktion israelischer Texte durch Judäa, die feindselig und hasserfüllt war und voller Annektionslust gegenüber diesen nördlichen Gebieten.
Wenn wir dem Judäer Jeremias, der viel später schreibt, Glauben schenken können (41,5), bleiben noch einzelne Gruppen von Hebräern, Israeliten mit Jahwe-Glauben, in den nördlichen Territorien. Aber mit Israel ist es unwiederbringlich zu Ende.
Dafür stieg nun Juda auf, und später wird es den Untergang Israels in seinem 'Buch der Könige' so begründen:
Und es geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den HERRN auf jedem hohen Hügel, ... Und die Söhne Israels ersannen gegen den HERRN, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren; und sie bauten sich Höhen (Höhenheiligtümer) in all ihren Städten... Und sie errichteten sich Gedenksteine und Ascherim (Aschera-Heiligtümer) auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum, und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar... und sie dienten den Götzen...(2 Könige, 17,7ff)
Wenn wir stattdessen den Ausgrabungen der Archäologie folgen, spricht nichts dafür, dass sich Israel von anderen kanaanäischen und sonstigen Fürstentümern der Großregion unterschied, Gott El/Jahwe taucht als ein Gott unter vielen auf, gelegentlich als Gatte der Aschera, und im bislang noch sehr ländlichen Judäa ist es wohl nicht anders. Das alles ändert sich erst mit dem nun stattfindenden Aufstieg Judäas zu einem eigenständigen Königreich. Aber das christliche Abendland wird nur den bald entstehenden judäischen Schriftenkanon kennen und und sich ausschließlich auf ihn beziehen (und beziehen können).
Etwa in der Zeit, in der Israel samt seinen sagenhaften 10 Stämmen untergeht, beginnt südlich davon der Aufstieg Judas. Anzeichen dafür sind ein rapider Bevölkerungsanstieg, Handel mit den Nachbarn, Anfänge „königlicher“ Verwaltung und der Aufstieg einer Jahwe-Priesterschaft im Jerusalemer Tempel. Dazu kommen die Anfänge von Schriftlichkeit.
Ähnlich wie in Israel herrscht eine Vielfalt von Kulten, in denen kanaanäische weibliche und männliche Gottheiten verehrt werden, und zwar in Jerusalem, bei den "Königen", wie in den ländlichen und nun städtischer werdenden Siedlungen drum herum. Jahwe ist ein Gott unter vielen, und oft gilt er weiter als mit Aschera verheiratet.
Finkelstein/Silberman vermuten, dass der Aufstieg Judas mit enger Anlehnung an Assyrien zusammenhängt (S.266). Es kommt wohl zur zeitweiligen Zusammenarbeit zwischen Königen und der Priesterschaft des Jahwe-Tempels. Ziel wird, vielleicht schon unter König Hiskia, spätestens aber unter Josia, ein einheitliches Zentralkönigtum mit einem einheitlichen Kult und einem einzigen Kultzentrum in der Hauptstadt Jerusalem.
König Hiskia wendet sich gegen Assyrien, worauf Sanherib fast ganz Juda einnimmt und weithin zerstört. Viele Judäer werden deportiert und auf der übrig gebliebenen Bevölkerung lasten heftige Tributzahlungen. Nachfolger Manasse verbindet sich eng mit Assyrien und der arabischen Welt und es kommt zu einem erneuten wirtschaftlichen Aufschwung. Die späteren judäischen Texte werden ihn als Bösewicht darstellen, der sich von Jahwe abwendet.
Erst unter König Josia (639-609) entsteht dann der große Juda/Israel-Mythos, wie er „Juden“ auszeichnet, wie sie nach der Eroberung Judas durch Babylon heißen werden, jener Mythos, an den auch diejenige jüdische Sekte anknüpfen wird, die dann irgendwann von den Römern als „Christen“ tituliert werden wird.
Finkelstein/Silberman beschreiben diese Wende so: „Josias messianische Rolle entspringt der Theologie einer neuen religiösen Bewegung, die dramatisch den Sinn des Begriffs „Israelit“ nachhaltig verändert und die Fundamente für das zukünftige Judentum - und damit auch für das Christentum – legt. Diese Bewegung bringt schließlich die Dokumente hervor, die den Kern der Bibel bilden, vor allem das wichtigste, ein Gesetzbuch, das bei der Renovierung des Jerusalemer Tempels im Jahre 622 v.Chr., dem 18. Regierungsjahr Josias, "entdeckt" wird. Dieses Buch, das von den meisten Gelehrten als ein Original des Buchs Deuteronomium identifiziert wird, bewirkt eine Revolution im Ritual und eine vollständige Neuformulierung der jüdisch-israelitischen Identität. Es enthält die zentralen Merkmale des biblischen Monotheismus: "die ausschließliche Verehrung eines Gottes an einem Ort; die zentralisierte, nationale Einhaltung der Hauptfeste des jüdischen Jahres (Passa, Laubhüttenfest) und eine Reihe von Gesetzen, die sich mit sozialer Wohlfahrt, Gerechtigkeit und persönlicher Moral befassen.“ (Finkelstein/Silberman, S.297)
Was später im zweiten Buch der Könige (22-23) beschrieben wird, die Entdeckung jener „Gesetze“, aus denen dann das Judentum entstehen wird, ist wohl ein Werk der Zusammenarbeit zwischen König und Tempelpriesterschaft:
Er ging zum Haus des Herrn hinauf mit allen Männern Judas und allen Einwohnern Jerusalems, den Priestern und Propheten und allem Volk, jung und alt. Er ließ ihnen alle Worte des Bundesbuches vorlesen, das im Haus des Herrn gefunden worden war. (Zweites Buch der Könige, 23,2)
Historisch steht Josia zwischen dem Niedergang assyrischer Herrschaft im Norden und dem Neuaufstieg Ägyptens unter Psammetich. Die Erfindung einer gemeinsamen Vorgeschichte Israels und Judas begründet nun die Perspektive der Eroberung Israels durch Juda als „Wiedereingliederung“, an die sich Josia mit dem Versuch der Eroberung von Samaria macht. Dabei scheitert er an den Ägyptern. Seine Nachfolger werden seine Pläne und seinen „nationalreligiösen“ Mythos nicht wieder aufnehmen. Juda wird im Konflikt mit Babylonien untergehen. Im Exil und danach wird es zur Schlussredaktion der bisherigen heiligen Schriften kommen. Dabei wird aus Juda Jehud werden, aus den Bewohnern Judas die Jehudim, die „Juden“, und das in Abhängigkeit vom persischen Reich.
Der Mythos und „das Gesetz“ überleben dann die Eroberung durch Alexander, die Einordnung unter das ägyptische Ptolemäerreich und das syrische Seleukidenreich. Judäa, wie Juda jetzt heißt, unterliegt einem zunehmenden Hellenisierungsdruck, Teile der Priesterschaft und die Familie der Makkabäer errichten unter Berufung auf "das Gesetz" ein Königreich, das in inneren Streitigkeiten im 1. Jahrhundert vom Halbaraber (Nabatäer) Herodes im Bündnis erst mit Pompeius, dann Antonius und schließlich Octavius/Octavian übernommen wird. Zur Zeit Jesu werden dessen Erben von den Römern entmachtet und das Land unter römische militärische Kontrolle und Verwaltung gestellt. Der erste Aufstand führt unter dem Befehl von Titus 71 (n.d.Zt.) zur Zerstörung des Tempels, der zweite unter Bar Kosiba/Kochba zur Zerstörung Jerusalems und Vertreibung der Juden in jene Diaspora, in der viele unter ihnen schon seit Jahrhunderten aus freien Stücken lebten (im Zweistromland, in Ägypten, in Kleinasien und westlich davon).
Über den Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk, wie er seit Josias formuliert wurde, schreiben Finkelstein/Silberman: „Die Saga von Israel, wie sie sich zur Zeit Josias zum ersten Mal herausbildete, wurde der erste, vollständig ausformulierte Nations- und Gesellschaftsvertrag der Welt, der die Männer, Frauen und Kinder, die Reichen und die Armen einer ganzen Gemeinschaft einbezieht.“ (S.337)
Jedenfalls wurden diese heiligen Schriften seit Kaiser Konstantin zu einer der Gründungsurkunden des „christlichen“ Abendlandes und damit ungeheuer wirkmächtig. Worum es sich dabei handelt, gilt es im folgenden zu untersuchen.
2. Mythos und Gesetz:
Heilige Schriften, heiliges Priestertum, heilige Herrschaft
Mythos und Gesetz haben zu allen Zeiten zusammengehört. In den letzten Jahrhunderten haben das die Klassiker des „Gesellschaftsvertrages“, des großen Mythos der modernen „Demokratien“ belegt: John Locke, Jean-Jacques Rousseau und viele andere. Eine solche vertraglich sich zusammenfindende „Gesellschaft“ hat es nie gegeben, es handelt sich in allen Fällen um Untertanenverbände, selbst in der attischen Polis und den frühen römischen res publica – und so auch in den modernen „Demokratien“. Polis, Res Publica und die jüdische Staatsvorstellung der Bibel beruhen alle drei höchstens auf Verträgen mit den Göttern bzw. dem einen Gott.
Um diesen Ein-Gott-Glauben, Monotheismus, soll es nun zunächst gehen. Bevor wir zu dessen entscheidender Besonderheit kommen – dass man sich kein Bild von ihm machen darf, ja nicht einmal seinen Namen aussprechen soll – ist dessen Entstehungsgeschichte, um die man sich früher so viele Gedanken machte, relativ einfach zu beschreiben.
JHWH, manchmal als Jahwe und manchmal als Jehovah ausgeschrieben (aber nicht von orthodoxen Juden), taucht zum ersten Mal 840 auf der Mescha-Stele auf, einem moabitischen Gedenkstein, auf dem der moabitische König die Befreiung eines Ortes aus der Herrschaft der Omriden feiert:

Und ich zog bei Nacht los und kämpfte gegen es vom Anbruch der Morgenröte bis Mittag. Und ich nahm es ein und tötete alle: siebentausend Männer und Sklaven und Frauen und Sklavinnen und Dirnen, denn ich hatte es dem Kemosch geweiht. Und ich nahm von dort die (Kult-)Geräte JHWHs und schleppte sie vor Kemosch.
Das Hebräische ist eine (fast) reine Konsonantenschrift, was erklärt, dass der Name dieses Gottes verschieden ausgesprochen werden könnte. Aber er soll laut Thora ohnehin geheim bleiben. Wichtig ist zunächst, dass es in Kanaan erst einmal ein Gott unter vielen war, und vermutlich als männlicher Gott ursprünglich mit dem Kult der Göttin Aschera verbunden, wie Inschriften des 8. und 7. Jahrhunderts belegen.
Im zweiten Buch der Könige wird diese Göttin (nach „Auffindung“ des 5. Buches Moses und erst dann) aus dem Tempel zu Jerusalem vertrieben:
Und der König befahl dem Hohepriester Hilkija und den Priestern zweiten Ranges und den Hütern des Schwelle, aus dem Tempelraum des HERRN alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie außerhalb Jerusalems in den Terassengärten am Kidron und ließ ihren Staub nach Bethel bringen. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende... (2 Könige, 23, 4-5)
Das lässt sich allerdings nicht archäologisch belegen und gilt nicht mehr für die Nachfolger des Josia. Von Joahas heißt es: Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn... (2 Könige, 23,32)
Wie sich ausführlich in den jüdischen Texten nachlesen lässt, entsteht dabei kein Monotheismus, der nur einen Gott kennt, sondern nur ein solcher, der einen unter vielen bevorzugt, und zwar exklusiv (Monolatrie). Was das Buch der Könige beschreibt und das letzte der Bücher Mosis festlegt, ist ein Bündnis von König und Jerusalemer Tempelpriesterschaft mit dem einen Gott bei Intoleranz gegenüber den anderen Göttern. Ein Monotheismus, der die Göttlichkeit der übrigen Götter, „Götzen“, bezweifelt, eine ungeheuerliche Neuigkeit, entsteht erst Jahrhunderte später.
Die Bevorzugung des einen Gottes JHWH erklärt sich aus seiner doppelten Begründung im Mythos: Er ist ein allmächtiger Kriegsgott (und darum männlich, der HERR), und er hat sich exklusiv mit einem „Volk“ verbündet, welches nach dem babylonischen Exil „Juden“ heißen wird. Dieses „Volk“ ist wie alle „Völker“ danach in die römische und nachrömische Tradition hinein eine Erfindung von Mächtigen, die einer ethnischen Begründung für ihre Untertanen bedürfen.
Die Thora-Bücher geben also eine völkische, eine kriegerische und eine staatsbildende (zivilisatorische) Begründung für den exklusiven Bund von JHWH und „seinem Volk“. Das unterscheidet sie nicht grundlegend von der polytheistischen Begründung von Staatlichkeit in den übrigen orientalischen Despotien, aber es betont einen extremen Zentralismus auf eine Hauptstadt, die entweder Königsstadt und exklusive Priesterstadt oder wenigstens alleine letzteres ist.
Wie weit die extreme Blut- und Bodenideologie des Alten Testamentes vor den Makkabäern und den radikalen Sekten, die bis ins neutestamentarische Zeitalter hineinreichen, ernstgenommen wurde, ist schwer auszumachen. Die Geschichte des Judenvolks als eine Familiengeschichte, die bei Abraham beginnt, zur Sippengeschichte und Geschichte von zwölf Stämmen wird, wobei immer auf tadellose Abstammung geachtet wird, und jede Vermischung mit anderen „Völkern“ (also Glaubensgemeinschaften und Herrschaften) abgelehnt wird, wird in den Texten nach Mosis immer wieder konterkariert durch sündige „Mischehen“ von „Kindern Israels“ mit Andersgläubigen, die nicht zum „Volk“ gehören, durch Eroberungen israelitischer und judäischer Potentaten (samt deren kultureller Überfremdung?), durch Aussiedlung von Hebräern durch Aramäer von Damaskus, durch Assyrer, Ägypter und Babylonier und zugleich Ansiedlung fremder Völkerschaften. Unter den Diadochen und Makkabäern wie in der Diaspora nimmt dann das Proselytentum zu, durch vollgültigen Übertritt zum Judentum und durch Teilnahme von Unbeschnittenen am jüdischen Gemeindeleben. Erst die Christianisierung des römischen Reiches führt zum massiven Abschluss des Judentums von der Außenwelt.
Diese Blut- und Boden-Ideologie, deren intensivster Ausdruck die Beschneidung am männlichen Fortpflanzungsorgan ist, und das rabiate Verbot der geschlechtlichen Vereinigung mit Ungläubigen, wird zwar über den jüdischen Stammesmythos zum Biologismus und nähert sich einer Art Rassismus, unterscheidet sich davon aber dann doch durch die religiöse Begründung.
Der „jüdische“ Geschichtsmythos leistet aber vor allem zunächst mehreres: Er begründet (und zwar nur er) den Anspruch des Königreiches Juda auf die Gebiete des ehemaligen Königreiches Israel. Dies tut er völlig ungeachtet der Tatsache, dass dort nur noch wenige Anhänger des JHWH-Kultes leben, wenige Leute hebräischer Sprache, wenige Leute, die mit dem Stammesmythos der Bücher Moses in Verbindung gebracht werden können: Die zehn nördlichen mythischen Stämme sind praktisch völlig verschwunden.
Er sakralisiert das judäische Königtum stärker als zuvor, indem die Könige zu Nachfolgern der mythischen Figuren Moses, Josua, David und Salomo werden, also von Repräsentanten von Großreichs-Prätentionen, die sich aus dem Bund JHWHs mit seinem „Volk“ ergeben. Josia, so wird im Buch der Könige betont, stammt aus der historisch nicht nachweisbaren Familie Davids. Noch das Matthäus-Evangelium wird mit einer akribischen Aufzählung der Abstammung Jesu von Abraham und David eingeleitet. Ein jüdischer Messias, ein Gesalbter also, ist, auch wenn er in der griechischen Version dann später zum christós wird, ein „Politikum“ - inwieweit er das unterschwellig in der frühen Jerusalemer Gemeinde des Jakobus war, wird sich kaum noch feststellen lassen. Die Evangelien werden alle nach den Schriften des Paulus schriftlich niedergelegt und unterliegen damit mehr oder weniger einer kaum noch nachvollziehbaren Christianisierung des Jesus-Bildes.
Der Geschichtsmythos begründet nicht zuletzt auch die enorme Macht einer Jerusalemer Priesterschaft, die eine Art königliches Monopol erhält: Es darf keinen Tempel und keine Priesterschaft neben ihnen geben, sie alleine hüten das Gesetz und sind die Herren des einzigen zentralen Kultes.
Bis zur letztmaligen Zerstörung des Tempels durch Titus ist der Tempelkult die eine Säule des „Judentums“, die andere ist das Gesetz, wie es im Deuteronomion ausformuliert ist, wie das fünfte Buch Mosis seit der Septuaginta-Übersetzung heißt: Zweites Gesetz.
Der komplette Stammesmythos begründet auch die priesterliche Macht: Einer der mythischen Stämme, die Leviten, erhält das erbliche Priesteramt, dies wird also biologisch definiert. Erst sehr viel später wird dies den Cohanim (Cohen) erblich überlassen, einer Oberpriesterschaft, die sich von den niederen Priestern absetzen, denen die niederen Tätigkeiten überlassen bleiben.
Dieser Priesterschaft wird wie auch sonst im Orient eine Art Zehnter zugesprochen, zu dem alle erstgeborenen Tiere gehören, die ersten Feldfrüchte und Geldwerte von entfernteren Gegenden. Damit werden die Priester zu einer festbezahlten Tempelbeamtenschaft und Hütern eines großen Tempelschatzes. Dafür müssen sie mehrmals im Jahr die Schohar blasen, Segen aussprechen, die rituelle Schlachtung der Opfertiere durchführen, die wenigen Jerusalemer Festtage mit ihren vielen Wallfahrern dorthin organisieren.(Landmann, S. 85ff für die historisch belegbare Zeit)
Der quasi-nationale Charakter des Tempelkultes wird durch „nationale“ Feiertage mit den Wallfahrten zahlreicher Pilger nach Jerusalem ergänzt, die die mosaische Geschichte in die Herzen der Menschen einbrennen und Geld in die Hauptstadt bringen sollen: Pessach, Passa, griechisch pas-cha, feiert den mythischen Auszug aus Ägypten, Schawuot ungefähr sieben Wochen später feiert die zweite Gabe des Gesetzes durch Gott, Sukkot, das Laubhüttenfest, ursprünglich wohl eine Art Erntedank mit schattenspendenden Laubhütten, feiert die Behausungen der Kinder Israels in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten.
Wie auch sonst im Orient und der europäischen Antike ist der Zugang zum Heiligtum dem Priestermonopol unterstellt. Den größten Abstand müssen die Frauen halten, aber die Sphäre des Opfers, das rituelle Schlachten des Opfertieres, ist allein den Priestern vorbehalten. Dabei wird das Blut als magischer Ort des Lebens tabuisiert, sein Genuss wird allen verboten. Blut und Opfer gehören untrennbar zusammen.
Die wesentliche Neuerung ist zunächst kein Monotheismus, nicht die Form des Opfer-Kultes oder der Charakter der Priesterschaft, sondern die Verehrung eines namenlosen und unsichtbaren Gottes: Du sollst dir kein Bildnis machen. Mit der rein männlichen Priesterschaft entstand dabei ein ausgesprochen männlicher Gott, der zwar keinen Namen hat, aber als HERR zumindest ein Geschlecht und in der Anrede als „Vater“ dann später auch eine patriarchale Autorität. Mit der Endredaktion zumindest der einen Sündenfallgeschichte wird den Frauen dann auch eine eher negative Rolle im Entstehungsmythos des Judentums zugesprochen, die erst etwas ausgeglichen wird durch die Schaffung von „nationalen“ Heldinnen wie Deborah und Esther.
Die Verehrung eines namenlosen Gottes, von dem man sich kein Bild machen darf, hindert nicht, ihn zugleich als einen hebräisch sprechenden Mann in den Texten darzustellen. Indem ER sich ganz auf die Seite „seines Volkes“ stellt, letztlich dieses schafft (erwählt), verschmilzt er laut heiliger Schriften zur Gänze ethnisch wie religiös mit diesem. Er ist also in doppelter Hinsicht ein Schöpfergott: Er schafft alles, was ist, und zudem schafft er sich sein eigenes „Volk“. Es wird einiges an inneren Konflikten hervorrufen, ihn einige Jahrzehnte nach Jesus erst den exklusiven Händen der Tempelpriesterschaft, den Sadduzäern und den jüdischen Zeloten zu entreißen, um ihn dann in die exklusive Obhut einer christlichen Priesterschaft zu bringen. Formell werden sich diese Konflikte an der Beschneidung, den Essensvorschriften und den jüdischen Festtagen aufhängen, die letztere zum Teil christianisiert werden.
Auf der anderen Seite gelingt das gerade deswegen, weil er namenlos und nicht abbildbar ist. Eine gelehrte Oberschicht hatte im Hellenismus längst philosophisch die Vorstellung eines höchsten Wesens entwickelt, ein griechisches hen, das Eine, ein stoisches summum bonum, ein höchstes Gut(es), woran sich später ein neuplatonischer Urquell von allem, was ist, und dem, was nur ein Schatten des Einen ist, anknüpfen wird.
Eine Priesterschaft in einem Tempel setzt sich im Verbund mit einem König gegen alle anderen Kulte durch und schafft so ein Volk. Dieses Volk, durch eine Sprache und ein Gesetz identifiziert, wird beflügelt durch eine nationale Mission. Das alles wird dargelegt in einem nationalen Mythos, der als Geschichte für bare Münze genommen wird.
Diese Geschichte wird zur Gänze als Geschichte des Verhältnisses dieses von ihm auserwählten „Volkes“ zu seinem Gott beschrieben. Geschichte wird damit sinnerfüllt, sie wird verstehbar, verständlich. Noch die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts wird von dieser Vorstellung einer sinnerfüllten Geschichte zehren.
Es gibt ein orthodoxes Judentum, welches (bis heute) nur die fünf Bücher Moses auf der Thora-Rolle als verbindliche heilige Schriften anerkennt. Dazu gehört damals die Tempelpriesterschaft, deren Macht auf den mosaischen Schriften beruht, und dazu gehört die vornehme und reiche Schicht der Sadduzäer, mit der Priesterschaft eng verbunden und zum Teil identisch.
Daneben entwickelt sich eine Tradition außerhalb des Tempels und dieses engen Kanons heiliger Schriften, aus der auch Jesus hervorgehen wird. Diese bezieht sich sehr stark auch auf Propheten wie Jesaja und die Psalmenliteratur. Es sind dies Lehrer, Rabbiner, „Schriftgelehrte“, Leute, die in den Evangelien manchmal auch „Pharisäer“ genannt werden.
Pharisäer sprechen eher die Masse der Menschen unterhalb der Sadduzäerkreise an und werden zu Experten der Auslegung des „Gesetzes“, also der vielen "mosaischen" Bestimmungen. Sie versuchen diese an die jeweiligen neuen Gegebenheiten anzupassen. Solche entstehende Schriftgelehrsamkeit wird in den Evangelien kritisiert zugunsten einer einfacheren Frömmigkeit. Zudem geschieht die Endredaktion der Evangelien nach dem Untergang der Tempelpriesterschaft und dem endgültigen Wandel des Judentums zu einem der Synagogen und Rabbiner. Insofern lässt sich mit der massiven Kritik an den „Pharisäern“ eine Kritik am Judentum überhaupt verbinden.
Was diese Leute andererseits mit den Evangelien verbindet, ist die Vorstellung eines Lebens nach dem Tode anders als die ältere jüdische Vorstellung von einem Schattendasein der Toten in der scheol, unter der Erde, „in der Grube“.
Antikes Judentum bis zum Ende des Tempels
Gegen Ende des 7. Jahrhunderts gelingt es Herrschern von Babylon, das Assyrerreich zu vernichten. 614 fällt Assur und 612 Ninive. 609 tötet Pharao Necho
II. Josias in Megiddo, setzt wenig später dessen Sohn ab und macht dann einen anderen Sohn zum König, den er in Jojakim umbenennt. Aber schon 605 besiegt Nebukadnezar das ägyptische Heer bei
Karkemisch am Euphrat.
Da Juda ebenso wie andere Kleinstaaten der Levante sich nicht dauerhaft dem babylonischen Herrscher unterwirft, wird es erobert, und 597/87Jerusalem
geplündert. Der dortige Kleinkönig wird zusammen mit Teilen der Oberschicht Jerusalems nach Babylon verschleppt, was sich nach einem Aufstand des Vasallenkönigs Zedekia 587 noch einmal
wiederholt. Nun wird auch ein Teil der Stadt und vielleicht der Tempel zerstört. Als Fazit lässt sich
sagen, dass Israel nur kurz und Juda fast nie wirklich unabhängige Reiche, sondern meist Spielball der großen Despotien sind. (Schipper)
Was immer Jerusalemer "religiöse" Propagandisten wie die Autoren von Psalmen später schreiben werden, alles spricht dafür, dass es den Judäern samt ihrem König an den Ufern von Babylon wie auch an anderen Orten dort recht gut geht. Ihnen wird Kronland zur Bewirtschaftung zugewiesen, und einige werden Beamte dort, andere Händler. Vielen gefällt es dort so gut, dass ihre Nachfahren später gar nicht mehr "zurückkehren" wollen
Im diesem babylonischen Exil verändert sich die jüdische Religion zumindest unter denen etwas, die unter persischer Hoheit zurückkehren werden (Esra, Nehemia).
550 löst sich der vergleichsweise tolerante persische Despot Kyros II. von den Medern und schafft ein großes Perserreich. 539 erobert er Babylon. 525 erobert Kambyses Ägypten, wo er sich zum Pharao ausrufen lässt. Juda wird die persische Provinz Jehud unter einem persischen Satrapen. Sie hat mit ihren rund 50x50 km Fläche und wenigen größeren Ortschaften vermutlich nur noch zwischen 10 000 und 30 000 Einwohner. (Schipper, S.78)
Wirtschaftlich geht es der kleinen Provinz wohl recht gut, Münzgeld kommt auf, erst
griechisches, allerdings erst nach 400 auch jehudisches. 520 kommt es unter den Persern zu einem Tempelneubau in Jerusalem. Offenbar will man der machtpolitisch und wirtschaftlich eher
unbedeutenden Satrapie für ihre Unterwerfung entgegenkommen.
Inzwischen tauchen Juden nicht nur in Jehud und in Mesopotamien auf, sondern auch auf der Nil-Insel Elephantine, wo sie den Jahwekult wohl auch mit dem anderer Götter verbinden und wenig auf die mosaischen Detailgebote geben. Ein weiteres sehr großes Jahwe-Heiligtum steht auf dem Berg Garizim bei Sichem, also auf dem Boden des vergangenen Israel und ist wohl nicht nur viel größer, sondern auch viel wichtiger für das Überleben eines "Judentums". Auch eine judäische Siedlung auf Zypern taucht bald auf.
Vielleicht erst 450 kommt es zur finalen Kanonisierung der Tora und damit zur Einführung des wöchentlichen Sabbat, der nun obligatorischen Beschneidung der männlichen Nachkommen, der Ablehnung der Ehe mit Andersgläubigen und zu einem unbedingten Monotheismus. (Schipper, S.92) Zugleich kommt es auch zum Ausschluss der Samarit(an)er aus dem Judentum. Die unheilvolle Arroganz von Religion, wie sie hier definiert wird, und die mit Esra und Nehemia nun "völkisch" wird, nimmt ihren Lauf und wird dann später unter temporärer Abschwächung des völkischen Aspektes von Christen und viel später vom Islam übernommen.
Inzwischen wird Jerusalem immerhin wieder auf 500 bis 1000 Einwohner angewachsen sein. Spätestens nun wird deutlich, warum die "Juden", wie sie nun heißen, die Judäer also, die inzwischen Israel für sich vereinnahmt haben, eine heroische Landnahme und großartige Könige in ihren Nationalmythos aufnehmen. Das soll ganz offenbar die Tatsache kompensieren, das Juda im Raum Palästinas und darüber hinaus eine fast völlig unbedeutende Rolle neben seinen mächtigeren Nachbarn spielt, was auch so bleiben wird.
Im 5. Jahrhundert scheitern die Perserkönige mit der Unterwerfung der Hellenen und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts entgleitet ihnen nach und nach Ägypten.
Der Makedonenherrscher Alexander besiegt Hellas und dann das Perserreich und regiert überall mit der brutalen Gewalt eines
orientalischen Despoten. Nachdem er sich zum persischen Großkönig gemacht hat, führt er einen Kriegszug über Palästina nach Ägypten, wo er sich nun auch noch zum Pharao erklärt. Mit der Gründung
der griechisch-ägyptischen Stadt Alexandria finden sich dort auch samarische und judäische Juden ein, die sich zur wohl größten jüdischen Gemeinde der Antike entwickeln.
Nach 333 kommt es unter den Ptolemäern, den Erben Alexanders ("des Großen"), zu erheblichem Einfluss des Hellenismus und
zunehmender Verbreitung von Juden über die damals bekannte Welt, auch durch militärische Maßnahmen der Ptolemäer forciert. Im 3. Jahrhundert wird dort dann eine Kompilation jüdischer Schriften
der letzten Jahrhunderte ins Griechische übersetzt, die später als "Altes Testament" dem christlichen neuen vorangestellt werden wird.
Judäa, wie es nun griechisch heißt, gerät unter ptolemäische Herrschaft und hellenistischen Einfluss, zugleich fördern die Herrscher die Tempelpriesterschaft und einen Ältestenrat der Stadt (gerusia) und alle die, die sich hellenisieren lassen, was wohl nicht wenige sind. Jerusalem wird nun etwas städtischer ausgebaut, die Münzen wirken griechischer, und griechische Götter tauchen als Dekor auf ebenso wie griechische Bildungseinrichtungen.
Inzwischen ist das Hohepriester-Amt zwischen zwei Familien erblich und gewinnt politischen Einfluss. Die eine der Familien
neigt den Seleukiden zu. Das Amt wird käuflich.Um 200 grenzt Rom militärisch die Macht der Makedonenkönige und der Seleukiden ein. Ein Vertreter der syrisch-seleukidischen Partei erkauft sich das
Amt des Hohepriesters mit Teilen des Tempelschatzes. Als jemand ihn darauf brutal beseitigt, plündert Antiochos IV. den Tempel und entwendet ihre Kultgeräte. Die Hellenisierung wird
vorangetrieben, die Beschneidung und der Sabbat werden schließlich verboten und das Opfern von Schweinefleisch im Tempel angeordnet.
Ab 167 mündet eine Protestbewegung dagegen in den Makkabäer-Aufstand gegen die Seleukiden-Herrscher. Es gibt nun eine
gewisse Koexistenz zwischen hellenischem Lebensstil und Tora-Observanz (Schipper, S.108) und neue militärische Expansion. Unter Jonathan toleriert der Seleukidenherrscher eine jüdische Regierung
unter seiner Oberhoheit.
142 wird das Judenland unabhängig unter den Hasmonäern, denen es gelingt sogar einen Mittelmeerhafen zu erobern. Tatsächlich handelt es sich bei ihnen um eine hellenisierte Familie. 129/28 zerstört ein Hasmonäerkönig das große Jahwe-Heiligtum auf dem Garizim und zerschneidet so endgültig das Band zwischen Juden und Samaritanern. Galiläa wird annektiert. Jerusalem wird zur Residenzstadt mit Palästen und großen Stadtmauern (zum ersten Mal) ausgebaut und wächst auf 8000 Einwohner an. Weitere Gebiete werden erobert, und wer sich der Judaisierung und Zwangsbeschneidung widersetzt, soll vertrieben worden sein. In der Jerusalemer Oberschicht kommt es zur Spaltung zwischen den "frommen" Pharisäern und den mit Teilen der Tempelpriesterschaft verbündeten Sadduzäern. Dazu kommen schließlich noch die Gruppen der Essener und der Gemeinde von Qumran. Letztere beteiligt sich nicht politisch, wendet sich sogar scharf gegen die verschiedenen politischen Vertreter. Stattdessen wird ein straff hierarchisch organisiertes Gemeinschaftsleben angestrebt, welches über die Regeln der Tora mit einem starken gut-böse-Dualismus und dem Gefühl, in einer Endzeit zu leben, hinausgeht. Einiges gemahnt bereits an den Jesus der Evangelien.
64 erobert Pompeius das Seleukidenreich und 63 Palästina. Im Jahr 40 wird Herodes zu einer Art abhängigem König von Judäa ernannt. Viele neue Bauten entstehen, darunter die Vergrößerung des Jerusalemer Tempelbezirkes : "Das Heiligtum wurde so zum Handels- und Marktplatz der Stadt." (Schipper, S.116)
Der historische, aber uns nur wenig zugängliche Jesus ist in der Zeit der Kaiser Augustus und Tiberius nicht der einzige Jude, den die römische Macht in Palästina als Unruhestifter einschätzt, und einige solche Rebellen gegen Rom aus dieser Zeit sind auch namentlich bekannt.
Auf Herodes folgen seine Söhne. 66-70 (n.d.Zt.) münden Massenproteste im Aufstand, den Vespasian im Auftrag von Kaiser Nero und dann Titus im Auftrag von Kaiser Vespasian niederschlagen lässt. Der Tempel wird geplündert und vollständig zerstört. Jerusalem wird in Aelia Capitolina verwandelt und Judäa wrd zur syria palaestina.
Das Judentum wird mit der dauerhaften Zerstörung seines Tempels unter römischer Herrschaft seinen Charakter etwas ändern. Als älteste (monotheistische) Religion wird es aber der Vorläufer für Christentum und den aus beiden erwachsenden und mit arabischem Sendungsbewusstsein angereicherten Islam werden. Zwar ist es aus einem Tempelkult samt Priesterschaft und deren Bündnis mit einem Machthaber hervorgegangen, aber das kultische Moment ist bald schwächer als das System von Vorstellungen und Vorschriften, aus denen das erwächst, was hier Religion genannt werden soll.
Von Jesus zu Paulus
Salcia Landmann hat ein hübsches Buch darüber geschrieben, warum Jesus in der damaligen jüdischen Tradition überhaupt nicht auftaucht. Ihre Antwort ist, dass er unter den damaligen „Meistern“, Lehrern, nur einer von vielen war.
Zwei weitere Antworten ließen sich hinzufügen: Er war Galiläer, lebte und wirkte also wohl an der Peripherie des Judentums, in einer Region, die noch nicht allzu lange und nicht durchgehend jüdisch geprägt und zudem sprachlich durch das Aramäische abgesondert war, auch wenn diese syrisch-semitische Sprache von den Historikern als eine Art lingua franca des Großraums dargestellt wird, - neben dem Griechischen. Fernab von Judäa, ist seine Region auch davon getrennt durch das Gebiet der Samaritaner/Samariter, also des Großraums von Samaria, dessen Bewohner nicht unbedingt für rechtgläubig gehalten werden. Zum anderen lässt sich vermuten, dass seine Anhängerschaft sehr klein bleibt.
Im Herzen jüdischen Lebens, in Jerusalem, taucht Jesus laut Evangelien nur zweimal auf, und das zweite Mal kurz vor seiner Hinrichtung. Er möchte dabei laut Evangelien die Geldwechsler aus dem Vorhof des Tempels werfen, deren Aufgabe es ist, die Opfermünzen der Pilger, die aus der Ferne kommen und ihren „Zehnten“ in fremden Münzen mit bildlichen Darstellungen geben, gegen „koschere“ Münzen einzuwechseln. (Landmann, S.71ff)
Nicht nur Landmann geht mit anderen davon aus, dass die Tempelpriester Jesus den Prozess machen wollten, weil er kurz vor dem höchsten jüdischen Feiertag eine Einnahmequelle des Tempels bedroht.
Aber nicht einmal zu diesem Prozess und der Hinrichtung Jesu gibt es auch nur den geringsten zeitgenössischen Hinweis. Pilatus, Hohepriester und Personen des obersten jüdischen Gerichts, des Sanhedrin, sind zwar nachweisbar. Aber das ganze Geschehen kann nicht so aufsehenerregend gewesen sein, wie es das Matthäus-Evangelium schildert.
Die eigentliche Gründungsurkunde des Christentums aber, die Auferstehung, die Verwandlung des Jesus in jenen Christus, der Gottes Sohn ist, widersetzt sich dem Verstand eines jeden, der an solche Wunder nicht zu glauben vermag.
Dass der evangelische Jesus Gott seinen Vater nennt, besagt zunächst nichts über eine spezifische Gottessohnschaft. Die mythischen „Kinder Israels“ haben sich, soweit sie gesetzestreu waren, immer auch als Kinder Gottes, ihres „Vaters“ gesehen. Im Christentum wird der Kleriker fromme Laien als „Sohn“ oder „Tochter“ anreden, und Übervater aller „katholischen“ Christen wird ein „Papa“ werden.
Inwieweit sich Jesus selbst eine besondere göttliche Abkunft zugesprochen hat, wird wohl der Spekulation überlassen bleiben müssen. Was er genau vertreten hat, wird sich ebenfalls nicht mehr exakt eruieren lassen. Die Texte von Qumram geben für meine laienhaften Augen keine definitive Verbindung her. Vielleicht ist der sogenannte Jakobusbrief und sind die ersten Passagen der Acta Apostulorum bei kritischer Lektüre hinweis-trächtiger als die späteren Evangelien selbst.
Der populäre Versuch, sich seinen „historischen“ Jesus aus den Evangelien
herauszukristallisieren, wie ihn zum Beispiel Deschner ungeniert versucht, bleibt in jedem Fall reine Spekulation. Der Versuch, ihn mit den Essenern des Flavius Josephus zusammenzubringen oder
dem „Lehrer der Gerechtigkeit“ der Qumram-Fragmente, scheitert daran, dass ein rein spekulatives Jesusbild zugrunde gelegt wird. Auch ein deutlicher
Bezug zu einem Täufer Johannes scheitert an der misslichen Quellenlage.
Die frühesten „christlichen“ Texte werden von der kritischen Bibelwissenschaft einem Paulus zugeschrieben; sie sollen zwischen 50 und 60 entstanden sein. Allein, wir wissen von ihm einmal nur durch die ihm zugeschriebenen Texte, zum anderen durch die möglicherweise deutlich spätere 'Apostelgeschichte“. Letztere zeichnet zunächst ein ausgesprochen idyllisches Bild von der Jerusalemer Gemeinde:
Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig Gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam; und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. (Apostelgeschichte 2,42-47)
Wenn davon irgend etwas historisch ist, dann handelt es sich hier um eine jüdische Sekte, die sich von ihrem Umfeld dadurch unterscheidet, dass sie das von Jesus angekündigte unmittelbar bevorstehende Reich Gottes erwartet und in dieser Erwartung ein intensives Gemeinschaftsleben pflegt. Abgesehen davon behalten sie wohl in manchem den jüdischen Glauben bei.
Sollte der sogenannte 'Jakobusbrief' die spätere griechische Überarbeitung eines Textes aus dieser jüdischen Gemeinde sein, so würde er uns genau davon eine Vorstellung geben und sich entsprechend von den späteren Evangelien unterscheiden. Es geht darin einerseits um das „Ausharren“ (Jakobus 1,2-4), also die Naherwartung der Wiederkunft des „Herrn“. ...denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen...Siehe, der Richter steht vor der Tür... (Jakobus 5,8-10) Die Reichen werden am Ende bestraft werden, weil sie sich zu sehr auf irdische Güter verlassen.
Des weiteren geht es um (jüdische) Gesetzestreue: Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller schuldig geworden. (Jak. 2,10) Dazu passt eine konsequente Werkgerechtigkeit: So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. (Jak. 2,17) Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden...(Jak. 2,21)
Im Kern handelt es sich um einen Text, der ermahnt, Konflikte und Streitereien innerhalb der Gemeinde zu lassen. Einen solchen Streit erwähnt die Apostelgeschichte:
In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden.(Apg 6,1:egéneto gongysmós tón Helleniston pros tous Hebraíos)
Ob solche „Hellenisten“ Juden aus der griechischen Diaspora waren oder grundsätzlich hellenistisch/griechisch beeinflusste Juden, lässt sich nicht mehr feststellen. Als Repräsentant der „Hellenisten“ tritt aber dann ein griechischer Jude aus Tarsos, eben Paulus auf.
Da er wohl Jesus nicht selbst gekannt hat, gründet er seine Beziehung zu ihm auf die visionäre Begegnung bei Damaskus. Große Teile der mündlichen Tradition, die in die synoptischen Evangelien eingehen wird, scheint er nicht gekannt zu haben, oder sie hat ihn jedenfalls nicht interessiert.
An die Galater gerichtet formuliert er das so: Ich teile euch aber mit, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. (Gal 1,11-12). Zweimal verflucht Paulus alle, die sich von diesem Evangelium abwenden.
Während die Judenchristen in Jerusalem auf die Wiederkunft ihres Herrn warten und dort und in der Umgebung missionieren, organisiert und beeinflusst er Gemeindeleben vor allem in den größeren Städten im griechischen Kleinasien.
Ich aber war den christlichen Gemeinden von Judäa von Angesicht unbekannt. (Gal.1,22). Nicht die Tradition der Verkündigung in Palästina mache Paulus zum Apostel, sondern die Tatsache, dass er schon im Mutterleib von Gott auserwählt worden war, einmal das Evangelium unter den Heiden (Nicht-Juden) zu verkünden. (Gal.1, 15-16).
Jakobus, Kephas (Petrus) und Johannes, die drei Säulen, erlaubten ihm die Heidenmission gegen die Bereitschaft, für die Jerusalemer Gemeinde Geld zu sammeln. (Gal.2) Aus seiner Vision, seinen Eingebungen und diesem Auftrag begründet er sein apostolisches Amt.
Inspiration (Einhauchen von Gottes Wort) war damit gelöst vom Gottessohn und gelöst von den Aposteln, die ihm persönlich gefolgt waren: Gott kann nun irgend jemandem sein Wort einflößen; das Christentum wird der Raum unterschiedlichster Inspirationen werden, die sich alle auf Gott berufen.
In der Apostelgeschichte versprachlicht sich die Trennung der griechischen von der Jerusalemer (ursprünglich galiläischen) Gemeinde in folgendem Teilsatz, den Luther mit „daher die Jünger am ersten zu Antiochia Christen genannt wurden.“ (Apg. 11,26 - chrematísai te próton en Antiocheía tous mathetás Christianoús)
Die kritische Bibelwissenschaft hat darum Paulus zum eigentlichen Religionsgründer gemacht. Im Jakobusbrief taucht Jesus als „der Gerechte“ auf, auch als „Herr der Herrlichkeit“, nicht aber als Gott oder wortwörtlicher Gottessohn. Bei Paulus wird selten einfach von Jesus, in der Regel von Jesus Christus bzw. dem Christus Jesus gesprochen.
Eines ist unübersehbar, das „Evangelium“, welches Paulus im Brief an die Römer und dem ersten an die Korinther predigt, dem an die Galater und dem ersten an die Leute von Thessaloniki, unterscheidet sich wesentlich von dem, welches (später?) in den drei synoptischen Evangelien gepredigt wird. So heißt es bei Paulus:
Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.(Römer 3,22.24)
Diese Gnadenlehre begründet sich aus der Interpretation des Opfertodes Jesu für die Sünden der Menschen. Im ersten Korintherbrief heißt es entsprechend: Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt. (1 Kor. 2,2) Der Mensch Jesu und sein Weg auf Erden tritt völlig zurück hinter die Botschaft von Opfertod und Auferstehung.
In völligem Gegensatz zu den späteren evangelischen Texten vertritt Paulus im Zentrum die Vorstellung von der unausweichlichen Sündhaftigkeit der Menschen, deren Erlösung nicht primär der Befolgung von Jesu Lehren, wie sie in den Evangelien stehen, sondern seines Opfertodes bedarf. Jesu Lehren reduziert er auf das Gebot der Nächstenliebe im wesentlichen.
Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. (Römer 3,10-12) Nach diesen Zitaten aus jüdischen heiligen Schriften heißt es dann: Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde .(Römer 3,20).
Das Gesetz war eine Hinzufügung zum Eingottglauben, die mit dem Opfertod Jesu hinfällig wird:
Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. (Galatherbrief 3,24) ...als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren, von einer Frau geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, (die) unter Gesetz (waren), damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater! (Gal 4,4-6)
In den Evangelien wird Jesus sagen: Folget mir nach. Bei Paulus steht: Glaubt, was ich verkündige, und ihr werdet auf Gottes Gnade treffen. (Siehe, ich, Paulus, sage euch... Galather 5,2) Paulus gesteht den Juden den Vorzug des Glaubens an den richtigen Gott zu, nicht aber die seligmachende Bedeutung der Befolgung ihres Gesetzes. Das entstehende Christentum wird ein Stück weit entjudaisiert.
Die Sonderrolle, die sich Juden zugeschrieben hatten, schwindet damit. Während der Jakobusbrief die Rechtfertigung Abrahams durch sein Werk gesichert sieht, lehnt Paulus genau das ab und sieht ihn „gerechtfertigt“ allein durch seinen Glauben. Da taucht dann der bemerkenswerte Satz auf: Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung.(Römer 4,15) Das jüdische Gesetz wird nicht adaptiert, sondern abgelöst durch ein Gebot der Brüderlichkeit, der Nächsten- und Feindesliebe.
Mit Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod (Römer 5,12), was später Augustinus ausarbeiten wird, und darum bedarf der notwendig sündige Mensch jener göttlichen Gnade, die erst durch den Glauben an Jesu Opfertod möglich wird. Diese Glaubenslehre formuliert eine scharfe Trennung von Leib und Geist, verurteilt den einen und lobt den anderen, sofern er gläubig ist.
...denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. (Römer 8, 13) Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.(Galather 5,24)
Das alles fehlt im wohl kurz danach geschriebenen ersten (Markus-) Evangelium, und taucht in abgewandelter Form erst Jahrzehnte später bei „Johannes“ in etwas anderer Form wieder auf. Die kulturbildende Domestikation des Menschen in eine Gemeinschaftsfähigkeit hinein, Triebaufschub und Verzicht, Kontrolle der Emotionen, Impulskontrolle, alles das wird nun aus der generellen Sündhaftigkeit der Menschen begründet und ihrer ewigen Verdammnis.
Mit durchgehender Betonung tauchen jetzt bei den Sünden des Fleisches immer wieder sexuelle Vergehen auf:
Darum hat Gott sie dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden... (Römer 1, 24) Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben... (Römer 1,26-27) Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei (1. Korinther, 5,1) Manche in der Gemeinde von Korinth waren Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Wollüstlinge, Knabenschänder (etc. 1.Kor. 6,9)
Die Erlösung unseres Leibes (Römer 8,23), die die Gemeinden anstreben sollen, ist die Erlösung vom „Fleisch“. Denn Jesus Christus, der Herr, wird unseren nichtigen Leib ... verklären, auf dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe... (Phil.3,21) Denn ich weiß, dass in mir, und das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. (Römer 7,18) In meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz, welchem dem Gesetz in meinem Geiste widerstrebt. (Römer 7,23) Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? (Römer 7,24)
Das ist der Bruch mit dem Judentum und womöglich auch mit den Judenchristen: Denn Christus ist des Gesetzes Ende (Römer 10,4). Auf diese Weise wird dann die Vorstellung vom zweiten Bund Gottes (dem „Neuen Testament“, kaine diatheke) entstehen, die der späteren Kanonisierung der neuen heiligen Schriften ihren Namen geben wird.
Im Hirtenbrief an die römische Gemeinde klingt das so über die Ungläubigen: Gott hat sie verführt in das Begehren (en tais epithymías) der Herzen, in die Unreinheit, auf das sie ihre Körper (sómata) an sich selbst schänden, die Gottes Wahrheit in die Lüge verwandelt haben und dem Geschöpf mehr dienen und es mehr ehren als den Schöpfer. (I,24 f).
Es ist verständlich, dass für das angestrebte paulinische Geistwesen Mensch der Geschlechtstrieb die größte Herausforderung ist, ganz anders als später in den synoptischen Evangelien:
...so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. (1 Kor 7,1) Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser, zu heiraten, als zu brennen.(1.Kor.8)
Widernatürlicher Geschlechtsverkehr, Homosexualität werden erwähnt, später die Knabenliebe. Aber der Gott des Evangeliums sieht alles und bestraft alles. Er prüft den Menschen „auf Herz und Nieren“.
Der Teufel des Paulus operiert ganz jüdisch und letztlich auch griechisch durch die Frau. Und ganz antik und nun auch als Exzess christlich wird bei Paulus der Geschlechtstrieb eingesperrt und domestiziert: Die Frau schweigt in der Kirche, sie bedeckt ihre Haare, sie ist dem Manne untertan.
Ganz bezeichnend wird folgende Stelle:
…bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht; aber solche werden Trübsal für das Fleisch haben; ich aber schone euch.(1.Kor.7,28) „Ichaber...“
Anders als bei den sehr unterschiedlichen Äußerungen des evangelischen Jesus zur Ehe schwingt sich Paulus zum Verkünder einer neuen Glaubenslehre auf, sortiert die verschiedenen mündlichen Traditionen zu Jesus, die wohl seine Aussprüche wiedergeben wollen, und bringt sie in sein Konzept.
Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen. (1Kor 9,1) Die Damaskus-Vision lässt ihn Jesus „sehen“, aber er hatte ihn nicht gehört wie die galiläischen Anhänger Jesu. Als „Apostel“ tritt er nicht nur mit „ich sage euch“ auf, sondern auch mit „ich will“:
Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. (1 Kor. 11,3) Und: Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist; die Frau aber ist des Mannes Abglanz.(1 Kor.11,7)
Daraus folgt dann: Wie in allen Gemeinden der Heiligen, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. (1.Kor 14,34) Verblüffend ist einmal die Begründung: Nicht Jesus/Christus sagt das, sondern „das (jüdische?) Gesetz“, und vor allem sollen das die Korinther halten wie „alle Gemeinden“. Nirgends bei Paulus wird so flagrant deutlich wie hier, wie er aus eigener „Eingebung“ Religion erfindet. Und solche Eingebungen kommen nicht zuletzt auch aus dem Judentum.
Damit reagiert Paulus auf zweierlei. Da ist einmal die Tatsache, dass viele seiner Gemeindemitglieder keine Juden, sondern „Heiden“ sind, und dabei ihrer eigenen Sexualmoral verhaftet. Dazu gehört, dass junge Männer vor der Heirat im Alter des ludus sexuelle Erfahrungen mit Huren machen, dass gewisse homosexuelle Praktiken nicht verpönt sind. Zum anderen demonstriert man stolz den Reichtum der Familie und den Rang in der Stadt.
Das andere ist ein Radikalismus, der sich zum Beispiel auf folgendes Paulus-Wort berufen kann:
Denn so viele von euch getauft sind, so viele haben sich Christus (wie ein Gewand) angezogen (enedúsasthe). Da ist dann kein Jude noch Grieche (mehr), kein Sklave oder Freier, kein Mann noch Frau (kein Männlicher oder Weiblicher).Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. (Gal.3,27-28)
Daraus werden, wie der erste Korintherbrief beschreibt, radikale Schlüsse gezogen, was Peter Brown so zusammenfasst:
„They would undo the elementary building blocks of conventional society. They would renounce marriage. Some would separate from pagan spouses; others would commit themselves to perpetual abstinence from sexual relations. The growing children for whose marriages they were responsible would remain virgins. As consequential as the Essenes, they would also free their slaves. Somewhat like the little groups described by Philo outside Alexandria, men and women together would await the coming of Jesus „holy in body and spirit.“" (Brown, S.53)
Aber: „A community of total celibates, and especially if it were a community in which women and slaves realized a little of the equality promised them, in ritual terms, at their baptism, would have been a community effectively sealed off against the outside world. But Paul had hoped to gather the gentiles into Israel in large numbers before Jesus returned from heaven.“ (Brown, S.54)
Der Römerbrief enthält noch zwei kernige Botschaften: Die eine ruft auf zur Bruder- und Feindesliebe, im 1. Korintherbrief ergänzt mit dem hübschen Appell an „Glaube, Hoffnung, Liebe“, der andere zur Unterwerfung unter die weltliche Macht, ...denn es ist keine Macht außer von Gott (Römer 13,1) und noch vehementer: Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse.(Römer 13,3)
Hamartía, die Sünde, fällt soweit mit dem zusammen, was die weltliche Macht für Verbrechen erklärt.
Indem sich Paulus mit der Realität heidenchristlicher, vor allem griechischer Christengemeinden beschäftigt, versucht er auch ganz Praktisches zu regeln beim gemeinsamen Warten auf das „Gericht“. Dabei verdoppelt sich das Verhalten der Gläubigen in ihrem Innenverhätnis einmal und ihrem Außenverhältnis in einer heidnischen Umwelt noch einmal. Nach innen gilt das aus der göttlichen Liebe begründete Liebesgebot untereinander, eines auch ganz praktischer Solidarität (qui enim diliget proximum, legem implevit, heißt es in der Sprache, die das Mittelalter prägen wird, im Römerbrief). Nach außen gilt der bedingungslose Gehorsam, hier im Lutherdeutsch: „Jedermann sey unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott verordnet.“ (Römer XIII,1). Hier ist Luther etwas sehr seinem Landesherrn gefällig.
Den „herrschenden Mächten“ soll sich nicht die Seele (pneúma), sondern die psychè unterwerfen, also der irdisch begehrende Teil des Menschen, damit der, der isst, trinkt, arbeitet, alles das tut, womit er als civis der römischen civitas nach außen positiv präsent ist. Damit ist der Innenraum der frühchristlichen Gemeinde abgeschottet von der ohnehin als leidige Notwendigkeit betrachteten Außenwelt, über die nicht die Gemeindemitglieder, sondern Gott sein fürchterliches Strafgericht herab regnen lassen wird. Die christlichen Gemeinden sollen also in eine Art innere Emigration gehen, sich durch ihr Verhalten nach außen möglichst wenig gefährden, denn sie haben Wichtigeres zu tun als äußeren Streit. Die Ansprüche des Paulus werden sich spätestens nach seinem Tod kaum noch irgendwo halten lassen.
Dabei taucht in der Vulgatafassung der Paulustexte das Gewissen als conscientia auf, die syneídesis, eine neutestamentarische Neubildung aus
dem griechischen Verb für zugleich sehen und erkennen (syn-oráw). Denn der Gehorsam nach außen soll nicht nur wegen dessen geschehen, was dem Ungehorsamen von der Staatsmacht droht,
sondern auch „um des Gewissens willen“ (dià tèn syneídesin). Das christliche Liebesgebot gilt eben auch noch gegenüber den Feinden.
In dieser Unterwerfung des Christen unter die irdische heidnische Macht übt er allerdings bei Paulus auch eine andere: In seinen Briefen sind „Älteste“ (presbyteroi) und Bischöfe (epískopoi) erwähnt, die in irgendeiner Form den Gemeinden vorstehen, wobei beide Wörter wohl damals dasselbe meinen. Angesichts der üblichen intellektuellen Minderleistungen der meisten (auch) Christen empfiehlt er ihnen eine geistliche Hierarchie, die an oberster Stelle das von Jesus gesprochene Wort Gottes ansiedelt, darunter die Apostel, zu denen sich Paulus hinzu kooptiert fühlt, darunter kommen diese Gemeindeoberen und dann die, die auf die Interpretation des Wortes Gottes durch die Intellektuelleren und „Reineren“ angewiesen sind. Paulus ist auch, wie er gelegentlich betont, einer der „Reinen“, hat er sein Leben doch völlig der Mission geweiht, verzichtet auf Weib und Kind, sexuelle Praxis und das Streben nach Eigentum.
Erklärlich ist vieles nur dadurch, dass auch bei Paulus noch die Naherwartung der Wiederkunft des Christus vorhanden ist, was die weltliche Macht zum Randphänomen macht.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. (1. Kor.15,51-52) Und so muss er erklären, warum Gemeindemitglieder vorher sterben: Wegen der nicht richtigen Einnahme des Abendmahles sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen.(1.Kor.11,30)
Zum Trost schreibt er an die Gemeinde von Thessaloniki:
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. (1. Thess 4,14-15)
Gelegentlich ist Paulus ausgesprochen schwer verständlich, wie im ersten
Korintherbrief:
...wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene (theú sophían en mysterío, ten apokekrymménen 1 Korinther 2, 6). Wir aber haben nicht den Geist (pneuma) der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind.. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten.“ ( pneumatikoís pneumatiká synkrínontes 1.Kor.2,13).
Damit wird das, was dann die synoptischen Evangelien zum Teil und vergleichsweise handfest beschreiben, Kreuzestod, Auferstehung, Himmelfahrt, in eine Sphäre gehoben, die an griechische Mysterienkulte erinnert. Der „Geist“, später „heiliger Geist“, bedarf denn auch der Einweihung, Einweisung.
Was bleibt zu tun für die Entstehung des Christentums nach Paulus: Aus Gott dem Vater, seinem „Sohn“ und dem (heiligen) „Geist“ wird im zweiten Jahrhundert die Trinität, der Versuch vor allem, mit der Gottessohnschaft Jesu fertig zu werden, ohne in einen Zwei-Götter-Glauben zu verfallen. Aus dem Abendmahl wird durch des Paulus Eingriff, dabei kein Sättigungsmahl (die sogenannte agape) mehr einzuhalten, die Eucharistie werden, das magische Kosten vom Leib Jesu, und vorher schon wird die Taufe als ritueller Akt eingeführt werden, zuerst als Erwachsenentaufe der Bekehrten und Belehrten (der Katechumenen). Indem diese beiden Akte ganz im Sinne des Paulus zu „Mysterien“ erklärt werden, wobei das griechische mysterion dann zum lateinischen sacramentum wird, wird es aus der Hand der Laien in die sakral herausgehobener Priester gelegt: Aus der Gemeinde wird im 2./3. Jahrhundert die Kirche (beides griechisch: ekklesia).
Inzwischen schwindet zunehmend die Erwartung, die Wiederkunft des Erlösers noch zu Lebzeiten mitzubekommen. Nach der paulinischen Wende, die die synoptischen Evangelien in vielen Punkten nicht mitvollziehen, kommt es zur zweiten, zum zunehmenden Sich Einrichten in dieser Welt und damit zur Anpassung an ihre Gegebenheiten.
Aber vorher, in den Jahrzehnten nach Paulus, entstehen die drei synoptischen Evangelien (plus den später von der
Kirche weitgehend vernichteten übrigen), zur paulinischen Glaubenslehre kommt nun die Verschriftlichung eines Lebens Jesu, seiner Taten und Aussprüche,
alles wohl auf einer mündlichen Tradition und vielleicht einer verlorengegangenen schriftlichen Quelle basierend, wobei man nur vermuten kann, was Paulus davon bekannt war.
Evangelischer Jesus
Dass es einen historischen Jesus gegeben hat, scheint kaum zweifelhaft, aber als Wanderprediger mit der Erwartung des unmittelbar bevorstehenden Weltenendes war er wohl nicht an einer Verschriftlichung seiner Lehre interessiert. Stattdessen entwickelt sich zunächst unter den frühen Judenchristen eine mündliche Tradition, die, wie man aus dem Studium der Evangelien des Matthäus und Lukas zu erschließen meint, zwischen 40 und 50 in einer schriftlichen Sprüchesammlung mündet, die nicht erhalten ist. Überhaupt ist davon auszugehen, dass viele frühchristliche Schriften verloren sind, ohne Spuren zu hinterlassen.
Nach den paulinischen Texten ist als nächstes, also mehr als eine Generation nach Jesu Tod, ein Evangelium überliefert, welches mit dem Namen Markus benannt ist. Es wurde offensichtlich im hellenistischen Syrien für dortige „Heidenchristen“, also solche, die vorher keine Juden waren, aufgeschrieben. Ihm fehlen die wohl erst später erfundene Kindheitsgeschichte Jesu und all die (angeblichen) Jesusworte, die die Evangelien nach Matthäus und Lukas dann aufnehmen.
Angenendt geht von zwei Textquellen aus: "Denn als ältester >Bericht< ist die Geschichte von Tod und Auferstehung Jesu anzusehen. Daran hat das erste Evangelium, das des Markus, Erzählstoff belehrender wie ermahnender Art, ferner Lehrsprüche sowie Wunder- und Beispielhandlungen hinzugefügt." (S.125)
Bei aller Verschiedenheit übernehmen ganz offensichtlich die Autoren der Evangelien, die später nach Matthäus und Lukas benannt werden, das Erzählte von Markus, ergänzt aber durch das Material der vermuteten Sprüchesammlung und durch Hinzugekommenes zur Kindheit und zur Auferstehung. Beide sind wohl zwischen 80 und 90 entstanden,, das Matthäus-Evangelium wohl für Syrien, das des Lukas vielleicht überhaupt für Heidenchristen, wie der Autor wohl selber einer war. Während Matthäus eher ein geschlossenes Gedankengut anbietet, ist Lukas der volkstümlich gewordene große Erzähler, besonders populär geworden mit seiner erfundenen Weihnachtsgeschichte.
Wiederum gut zehn Jahre später setzt die Forschung das sogenannte Johannes-Evangelium an, welches sich in wesentlichen Punkten von den drei vorausgegangenen unterscheidet. Der schon bei Lukas deutliche Bruch mit dem Judentum ist nun in starke Ablehnung vertieft, weshalb man einen heidenchristlichen Autor vermutet. Vielleicht kannte der Autor die drei synoptischen Evangelien, aber er ist weniger an der Geschichte eines historischen Jesus interessiert als an seiner philosophisch/theologischen Bedeutung. Vermutet wird eine Nähe des Autors zur Gnosis, die dazu passen würde, dass seine Anhängerschaft einen Randbereich in der Großkirche einnimmt, was wiederum dort zu viel Widerstand gegen eine Aufnahme in den Kanon des „Neuen Testamentes“ führt.
Neben und nach diesen später in einen festen Kanon eingebundenen Schriften (samt der Apokalypse im 3./4.Jh. weitgehend festgelegt) gab es all die, die verloren gehen, und die wohl fast alle etwas später entstandenen sogenannten apokryphen Schriften, die in der Mehrzahl der Gemeinden nicht akzeptiert und schließlich von der Kirchenspitze abgelehnt und am Ende verboten werden. Sie zeugen von einer erheblichen Vielfalt christlicher Vorstellungen, die mit der Entstehung einer einheitlichen und dogmatisch sich verhärtenden Kirche erst verschwindet.
Da gibt es die erheblichen Unterschiede zwischen Judenchristen und Heidenchristen, die erst mit dem massiven Zurückdrängen des judenchristlichen Einflusses vergehen, da gibt es Positionen einer Ablehnung des Alten Testamentes mit seinem vom paulinischen so verschiedenen Gott, da gibt es die ethischen und asketischen Rigoristen, die manchmal den Frauen eine stärkere Rolle im Christentum zusprachen, da gibt es die Großgruppe der Gnosis, in der unterschiedliche Kreise den individuell zu leistenden und nur wenigen gelingenden Aufstieg vom fleischlichen über den seelischen zum geistigen Menschen beschreiben, der alleine „die Wiedervereinigung mit dem Göttlichen“ erlangen lässt (Ceming/Werlitz, S. 35, an deren Buch ich mich für die Entstehung der evangelischen Texte weithin halte). Dabei muss der Gläubige einen Weg der Erkenntnis (gnosis) beschreiben, der keines kirchlichen Beistandes bedarf, was alleine schon Gnostiker für den Klerus der entstehenden Großkirche zu Häretikern macht.
Mit der Ablehnung und dem Verbot verlieren die Apokryphen ihren Wert für die Theologie, nicht aber für den Volksglauben, in dem sie bis tief ins Mittelalter hineinleben. „Viele Marienfeste des Mittelalters haben ihren Ursprung in den Apokryphen, z.B. „Maria Geburt“, „Maria Opferung“, „Fest der heiligen Joachim und Anna“ sowie das Fest der „Unbefleckten Empfängnis Mariens“. (Ceming/Werlitz, S.63) Nicht nur dieses letztere, sondern überhaupt auch die Dogmatisierung der Jungfräulichkeit Mariens beruht ganz stark auf dem apokryphen Jakobus-Evangelium.
In der mittelalterlichen Kunst gehen Darstellungen von Tod und Himmelfahrt Mariens auf die Apokryphen zurück, ebenso wie solche der Höllenfahrt Jesu. (Ceming/Werlitz, S. 64f)
Auf der Suche nach dem historischen Jesus bleibt dem kritischen Leser der drei Evangelien vor dem des Johannes, welches ich hier erst einmal abtrenne, nur wenig Handfestes: Seine ethnische Herkunft ist ungewiss, seine „Geschichte“ spielt sich in dem Spannungsfeld von Galiläa, Judäa und Samaria ab. Mit dem Geburtsort Bethlehem käme er aus dem „jüdischen Land“ (tes Ioudaías), wie es bei Matthäus heißt, aber seine Herkunft ist aus Nazareth in Galilea. Dorthin schickt Lukas den Engel Gabriel, eis pólin tes Galilaías, he ónoma Nazarét.
Bethlehem ist, wie Lukas betont, die „Stadt Davids“, aber all dies ist märchenhaft, bis hin zur Person eines „König David“. Die kuriose Abkunftslinie des Jesus von David, anderswo von Abraham, wird zwar mittelalterlichen Herrschergenealogien und den legendären Herkunftsgeschichten von Adelsfamilien zum Vorbild gereichen, lässt sich aber ebenso leicht in das Reich der Fiktionen verbannen.
Neben dem königlichen Stammbaum, ein Aspekt jüdischen „Stolzes“ - und der Einbettung des Jesus in das jüdische „Nationalepos“, was ihn dadurch auch zum Teil einer jüdischen Heilsgeschichte macht, schieben Matthäus und Lukas vor den vielleicht historischen Jesus die Geschichte seiner damals und noch später offensichtlich glaubhaften spirituellen Insemination Mariens durch den jüdischen Gott. Was folgt, sind Geburts- Kindheits- und Jugendgeschichten, die erfunden werden, um die Gottessohnschaft ausführlicher darzustellen, seine Berufung eben.
Das ohnehin kürzere Markus-Evangelium lässt alle diese recht märchenhaften Begebenheiten aus und beginnt dort, wo sich ein historischer Jesus immerhin vermuten lässt: In der Begegnung mit dem Täufer Johannes. Etwas handfester wenigstens wirken dann die wenigen Wanderprediger-Jahre des gerade Dreißigjährigen, der seine Bekehrung bei Johannes und in einem eremitenartigen Rückzug „in die Wüste“ erfahren hat.
Während das Lukas-Evangelium stärkere erzählerische Qualitäten besitzt, was schon gleich zu Anfang Vorgeschichte und Weihnachtsgeschichte erweisen, halten wir uns für die im Kern allen drei Evangelien gemeinsame Substanz an Matthäus. In der Welt dieses Autors ringen zwei Mächte um die Menschen und die „Welt“, den kósmos. Da ist ein diábolos, also wörtlich einer, der alles durcheinander wirft, der selten einmal auch als jüdischer sátanas auftritt. Sein Gegenspieler ist theós, der kýrios ist, der Herr (für das lateinische Mittelalter: dominus in der Vulgata).
In dieser anhellenisierten jüdischen Provinz im Römischen Imperium ist die klassisch hellenische Vorstellung vom Kosmos als einer wohlgeordneten, letztlich schönen Welt, der sich die kultivierten Menschen nur anzuverwandeln brauchen, hier einer Welt gewichen, die mehr dem mundus der Römer entspricht (wie die Vulgata kósmos übersetzt), allerdings ins Schreckliche gewendet durch die Macht des diábolos, der an einer Stelle bei Johannes schon als jener „Fürst dieser Welt“ auftaucht, als der er am Ende auch dem jungen Luther erscheint.
In der rundum vorwissenschaftlichen Welt der drei Evangelien vermitteln Götterboten zwischen Gott und Menschen, die ángeloi, während der Teufel auch in der Mehrzahl auftritt - als Dämonen oder „böse Geister.
Dem bislang (seit dem jüdischen Sündenfall) dem Teufel anheimgefallenen, numehr unordentlichen Kosmos steht eine andere Sphäre gegenüber, he basileía ton ouranón, das Königreich des Himmels. Dieser ouranós war schon bei den Griechen ein Wohnsitz der Götter gewesen. Ähnlich wie im Deutschen und anders als im Englischen ist dieser göttliche Himmel aber zugleich auch der „physische“, der sich über der Erde bzw. um sie wölbt. Diese sprachliche Möglichkeit erlaubt dann bei Lukas folgende "Himmel"fahrt Jesu: kaì anephéreto eis tòn ouranón (ferebatur in coelum).
Jenseits der für Heutige teils schwer verdaulichen „Wunder“, er geht zum Beispiel auf dem Wasser, verwandelt Wasser in Wein und vermehrt Lebensmittel wundersam, stehen zahlreiche Wunderheilungen vermutlich physischer, psychosomatischer und psychischer Krankheiten (Teufelsaustreibungen vor allem). Mit den Wundern beweist er laut Evangelisten seine „übernatürliche“ Abkunft, seine Gottessohnschaft.

Auf diesem Gemälde aus der Priscilla-Katakombe ist Jesus ein freundlicher junger Römer, der sich als guter Hirte betätigt. Genau so stellen ihn auch die Evangelien in seiner Wundertätigkeit, in seiner Forderung nach bedingungsloser Nächstenliebe und seiner Parteinahme für die Schwachen und die reuigen Sünder dar.
Die Substanz seiner Predigten und gleichnishaften Geschichten ist eine ganz andere. Im Markus-Evangelium X, 17 ff (ziemlich wörtwörtlich genauso bei Lukas) tritt ein gleichsam alles fordernder Heilsbringer auf, der einem wohlhabenden jungen Mann, der immerhin schon mal alle „Gebote“ einhält, folgendermaßen erwidert:
O de Iesous emblépsas autó egápesan autón kaì eipen autó: Eines fehlt dir; gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gibs den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel (thesauròn en ouranó) haben; und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. (Luther - Übersetzung)
Die Vergangenheitsform von agapáo, lieben, wertschätzen besagt, dass Jesus ihn „liebte“. Aber dennoch, ohne dass er auch das Letzte gibt, kann er nicht „das ewige Leben erben“ (zoèn aiónion kleronoméso).
Darum aber geht es in allen vier Evangelien: Nur der radikale Verzicht auf alles „Irdische“ erringt das Himmelreich. Dazu gehört alles Eigentum, dazu gehören alle Bindungen an Menschen außer der an Jesus selbst. Estote ergo vos perfecti heißt es bei Matthäus V,48 in der Vulgata-Version. „Seid also vollkommen (griech: téleioi), so wie der Vater im Himmel vollkommen ist“. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“, wie Luther hier wortwörtlich und korrekt aus dem griechischen Original übersetzt. Deshalb kommen die Reichen so schwerlich ins Himmelreich, denn sie haben vorher zu viel zu verlieren.
Wer Jesus nachfolgt, soll auch keinem Broterwerb mehr nachgehen, schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht und sie spinnen auch nicht. (sie mühen sich nicht ab ist die wörtliche griechische Übersetzung, die im Latein zu non laborant wird). Da die Lilien grammatisch feminin sind, erhalten sie auch ein „weibliches“ Handwerk zugeordnet.
Als die Apostel zum Missionieren ausgeschickt werden (Matthäus X), sollen sie „keine Tasche“ mitnehmen, keinen zweiten Rock, wie Luther schreibt (Vulg.: neque duas tunicas), „keine Schuhe“, keinen Wanderstock. Áxios gar ho ergátes tes trophés autoú, der Arbeiter ist seiner Nahrung würdig. Arbeiter ist hier der missionierende Prediger.
Der Jesus des Matthäus-Evangeliums ist nicht nur ein guter Hirte, sondern einer, der droht: X, 34 ist die heftigste derartige Stelle: „Ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, den Frieden auf Erden zu bringen (eirénen epì tèn gen), sondern das Schwert (oder den Dolch: máchairan). Denn ich bin gekommen, den Menschen mit seinem Vater zu entzweien (dichásai), und die Tochter gegen die Mutter aufzubringen, und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter.“ Gemeint ist, dass ihm nachzufolgen alle Familienbande zerreißt.
Als Jesus in Matthäus XII gemeldet wird, dass seine Mutter und Brüder draußen seien und zu ihm wollten, antwortet er mit den fürchterlichen Worten: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus zu seinen Jüngern (epì tous mathetàs / discipulos) und sprach: Seht (idoú / ecce), das sind meine Mutter und meine Brüder! Beim Evangelisten Johannes wird Jesus bei der Hochzeit zu Kana seine Mutter, die etwas zu ihm sagt, anfahren: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. (Das ist schönstes Lutherdeutsch für: Tí emoì ka`soí, gýnai; oúpo hékei he hóra mou.) Die Stunde der Mutter wird bekanntlich die der Beweinung des Leichnams ihres Sohnes werden. Bei Johannes redet er zu ihr zum ersten Mal vom Kreuz herab: Weib, siehe, dies ist dein Sohn. (XIX,26)
XIX, 29 wiederholt Matthäus das Versprechen mit der impliziten Drohung:
Und alle, die das Haus und die Brüder, die Schwestern, den Vater, die Mutter, die Ehefrau (he gynaíka), die Kinder (he tékna), die Äcker verlassen um meines Namens willen, bekommen es hundertfach zurück und werden das ewige Leben erhalten. Anders gesagt, die anderen sind verdammt.
Neben all dem gilt es auch, jene Gelehrsamkeit abzulegen, wie sie die in einer stehenden Wendung in den Evangelien ständig diffamierten „Pharisäer und Schriftgelehrten“ verkörpern. Gegen diese Intellektuellen, die für ihn Heuchler sind, vertritt er eine kindlich einfache Gläubigkeit, das „Werden wie die Kinder“.
Neben der Armut, der Bindungs- und Wohnortlosigkeit radikalisiert der evangelisch überlieferte Jesus die vorhandenen ethischen Normen, die er ihrer jüdischen Formen entkleidet. Direkt unterhalb der Liebe zu Gott (was immer das damals sein mochte) und des Glaubens an seine Gottessohnschaft und damit an die absolute Wahrheit seiner Äußerungen steht als nächstes jene kaum lebbare „Nächstenliebe“, die er bis zur Feindesliebe verformt. Dazu gehört unmittelbar die totale Gewaltlosigkeit, die im Erdulden aller Gewalttaten gipfelt sowie in der Seligpreisung von Verfolgung im Zeichen der „Gerechtigkeit (dikaiosýne). Sowohl in der Bergpredigt des Matthäus wie in der ähnlichen „Feldpredigt“ des Lukas (wie Luther sie nennt), werden „Sanftmut“ und „Barmherzigkeit“ gefordert und freudige Hoffnung auf die Belohnung im Jenseits des „ewigen Lebens“.
Die formalisierte und ritualisierte Religion der Juden, von ihrer Priesterschaft und Oberschicht vor allem vertreten, wird auf diesem Wege notgedrungen unaufhörlich durchbrochen. Nächstenliebe geht vor Sabbatgebot, Reinheitsgeboten, auch das faktische Predigtmonopol der Priesterschaft wird zerstört.
Die Kernbotschaft lautet in Matth IV, 17 folgendermaßen: „Tut Buße (metanoeíte / poenitentiam agite) das Himmelreich ist nahe herbei gekommen.“ Meta-noéo meint sich umbesinnen, auch bereuen, die poenitentia ist die das Schamgefühl berührende Reue. In Matth X,7 ist das der präzise Predigtauftrag an die Apostel. Buße ist also ein innerlicher Vorgang, nicht, wie dann im antiken Christentum etwas, was „äußere“ Taten erfordert.
Diese Nähe des „Himmelreiches“, die das Koine-Griechische nur als „Königsherrschaft Gottes“ formulieren kann, ist eine zeitliche. An mehreren Stellen macht Jesus deutlich, dass seine Jünger sie irgendwann selbst erleben können. Er wird sterben, dadurch zu christós werden, der griechischen Übersetzung für Messias, der im germanisch-deutschen Mittelalter zum „Heliand“ wird bzw. zum „Heiland“. Wie wir dann erfahren, wird er einigen seiner Anhänger als „Auferstandener“ erscheinen, um ihnen deutlich zu machen, was sie als treue Gläubige selbst erwarten dürfen, wobei ausdrücklich darauf hingeweisen wird, dass keine „Verwesung“ des toten Leibes stattfindet. Dann verspricht er die eigene Wiederkunft, zu der neben der „Verklärung“ der Gläubigen ein furchtbares Strafgericht über die Ungläubigen niederfahren wird. Um zu verdeutlichen, was „er“ hier meint, heißt es zum Beispiel über eine Stadt, die keine Apostel aufnehmen mag: Amèn, légo hymín: Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Leute von Sodom und Gomorrha wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts (en heméra kríseos), als solch einer Stadt. (Matth. X, 15). Die Krisis ist die Unterscheidung und die Entscheidung und im Koiné-Griechisch des Neuen Testamentes auch der Gerichtshof.
Vor diesem „Gerichtshof“ müssen die Menschen Rechenschaft ablegen (in der Vulgata: rationem reddere) wie vor einem irdischen Gericht. Ein Heulen und Zähneklappern wird für die bleiben, die in die äußersten Finsternisse verstoßen werden (Matth. VIII,12), die ein Feuerofen sind (Matth.XIII, 42). Und Matt. XIII, 49f. So wird es am Ende aller Zeiten sein (Vulgata: consummatione saeculi). Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten (ek tón dikaíon) trennen und werden sie in den Feuerofen (Vulg.caminum ignis) werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein.
Der strenge Gott ist zugleich ein gnädiger für einige: Die einen werden in seine Gnade aufgenommen, die anderen verstößt er in den Tod und die ewige Verdammnis. Insofern kann sich Calvins „Praedestinationslehre“ problemlos an den Evangelien orientieren. Verdammnis, das hört sich bei Matthäus auch so an: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. (Luthers Matthäus, XXV, 41)
Die Evangelisten beschreiben die Bekehrung Jesu bei Johannes und in der Wüste so, als habe er sich an alttestamentarischen Stellen orientiert, um seine Rolle zu finden. Wenn er sagt, er sei gekommen, „um die Schrift zu erfüllen“, dann belegen er und die Autoren das mit zahlreichen Bibelstellen wieder und wieder an vielem, was geschieht.
Deshalb der Ritt auf der Eselin nach Jerusalem, zu den „Juden“, an ihrem höchsten Fest, wobei er sie durch Predigen in ihrem höchsten Heiligtum provoziert: Er muss sterben, „um die Schrift zu erfüllen.“ Der Weg nach Jerusalem ist der ins jüdische Establishment, ins Zentrum seiner Feinde. Neben seiner Feindseligkeit gegen alle Orte, die seinen Anhängern die Gefolgschaft verwehren, ist es vor allem Feindseligkeit gegenüber Jerusalem, die ihn prägt. Im auch hier prächtigen Lutherdeutsch:
Oh Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammlen wollen, wie eine Henne versammlet ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden ... (Zum Tempel:) Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Eine große Not wird kommen (thlípsis), Sonne und Mond werden nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden sich in Bewegung setzen (Vulg.: virtutes coelorum commovebuntur). ... Darauf wird am Ende des Weltenendes der Menschensohn in den Wolken des Himmels sichtbar werden mit großer Kraft und Herrlichkeit (metà dynámeos kaì dóxes pollís). Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammlen seine Auserwähleten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. (Luthers Übersetzung wiederum. Alles in Matthäus XXIII, 37 und verstreut bis XXIV, 31)
Dies alles ist sehr bildhaft, sehr naiv und recht märchenhaft für uns heute. Das Königtum Gottes, das ewige Leben und der sagenhafte Weltuntergang vorher bleiben für den Intellekt vage, wenig definitiv, und wirklich klar wird in den drei Evangelien auch nicht, wer nun das ewige Leben erringen wird: Genügt, wie an einigen Stellen formuliert, der Glaube an Jesu, also an seine Gottessohnschaft? Beinhaltet das den wortwörtlichen Glauben an alles, was er gesagt hat? Bei Paulus wird es genau so sein, anachronistisch gesprochen spricht Jesus als zukünftiger Christus immer ex kathedra, vom Lehrstuhl aus.
Bei Johannes wird das apokalyptische Zähneklappern spiritualisiert und alles relativ einfach: Wer mein Wort (ho lógos) hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht vor das Gericht. ... Es kommt die Stunde, und sie ist schon jetzt da (wo Jesus bereits zu Lebzeiten von den Toten auferweckt), dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. (Joh. V, 24f)
Die sogenannten 'Acta', die Apostelgeschichte, beginnt mit dem gemeinsamen Leben der Apostel, der vita communis, und der Erklärung, sie haben alles verkauft und zu Gemeineigentum gemacht, welches nach Bedürftigkeit (unter ihnen) verteilt wird.
Dies alles wird neu interpretiert durch das „Evangelium nach Johannes“, welches vorgibt, von Jesu „Lieblingsjünger“ geschrieben worden zu sein – der evangelische Jesus war auch in seinen Präferenzen und Benachteiligungen zumindest in diesem „Evangelium“ sehr menschlich, was sich auch zu seiner (nicht explizit erotisch ausgestalteten) Nähe hier zu einer Anzahl Frauen zeigt.
Das Johannes-Evangelium beginnt mit einer neuen Sprache, einer neuen Begrifflichkeit.
Von allem Anfang an war der lógos, und der lógos war bei Gott und Gott war der lógos. ... Alle Dinge sind durch ihn gemacht; unter dem Gemachten (Erschaffenen) ist nichts ohne ihn gemacht. (Joh. I,1ff)
Wenn Worte ausgesprochenes Gedachtes sind, dann ist dieser Gott ein spiritualisierter, ein gedanklich vorgestellter, ein als Gedanke vorgestellter. Wer immer dieser theós ist, er knüpft nicht mehr unmittelbar an den jüdischen Gott an, eher an klassisch griechische Vorstellungen. In der Lutherbibel heißt es: „Niemand hat Gott je gesehen,; der eingeborene Sohn (hyòs monogenès / filius unigenitus), der in des Vaters Schoß ist (kólpos ist der Busen und der Mutterschoß), der hat es uns erzählt.“ (Joh. I, 18)
Der Logos ist sowohl das Wort wie der Vernunftgedanke und die logische Struktur der Welt als Gottes Schöpfung. Zwischen der Welt vor dem Sündenfall, ihrem Schöpfer und der spirituell-vernunftigen Mittlerschaft bestand also eine Einheit. Für Johannes und Paulus wird die Wiederherstellung dieser inzwischen kontaminierten Welt nur noch über ihre mentale Ablehnung stattfinden können, und zwar in der Erwartung der nahen Wiederkunft Jesu, mit dem diese Wiedervereinigung als Ablösung alles Physischen vom „Geistigen“ sich vollziehen wird.
Als Lieblingsjünger ist laut diesem Evangelium Johannes der, der seinen Kopf auch an die Brust (kólpos) Jesu lehnt, um in intimer körperlicher Nähe zu ihm zu sein. Wie das Roger Weyden-Gemälde zeigt, ist er auch jener, der abgesehen von den Frauen unter dem Kreuz steht, als sich die Apostelschar offenbar erst einmal zerstreut hat.
Dass die Welt der Text Gottes sei, wird, um es nicht zu prosaisch zu machen, mit einer Licht-Metaphorik versehen: „In ihm war das Leben (zoè), und das Leben war das Licht (phós) der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis verstand es nicht (he skotía autò ou katélaben)“.
Dieser Gott, der das Wort ist und das Licht, „ward Fleisch“ (sàrx egéneto), und „voller Gnade und Wahrheit“. Die beiden klassisch griechischen Wörter dafür, die lateinisch massiv verwandelt als gratia und veritas das Mittelalter beeinflussen werden, heißen cháris und alethéia. Charis ist die Anmut und der damit verbundene Liebesdienst, die Anerkennung, der Dank und der Lohn. Man sollte dazu wissen, dass die griechischen Chariten als Verkörperungen der Anmut im Gefolge der Aphrodite sind, und in römischer Übernahme die drei Grazien (gratiae) werden. Chaire, kecharitoméne, grüßt Gabriel Maria bei der Verkündigung: Freue dich (als: sei gegrüßt), du Angenehme, Wohlgefällige. Gemeint ist die, die Gott für wohlgefällig ansieht bzw. dazu gemacht hat. Dieser Gott ist der zukünftige der Liebe (agápe), wie man sieht. Platos Symposion lässt aus der Ferne grüßen.
Die Aletheia ist wohl unmittelbar der griechischen Philosophie entlehnt. Gemeint ist also nicht die Wahrheit im Gegensatz zur Lüge primär, sondern jene, die in den Dingen enthalten ist und aus ihnen aufscheint, für das geschulte Auge aufleuchtet, Licht eben. Johannes der Täufer erkennt die Gottessohnschaft Jesu daran, dass in ihm der „heilige Geist“ wirkt, das pneúma, welches hágios ist. Nun fehlt zu einer konzisen und konsistenten katholischen Theologie nur noch des Täufers durch den Evangelisten Johannes vermittelte Erkenntnis: „Das ist das Lamm Gottes, dies ist es, welches der Welt Sünden trägt.“ (I, 29). Das Lamm ist das jüdische Opferlamm, und die hamartía ist etwas, was Griechen so nicht kannten. Hier wird in das Wort für den begangenen Fehler, den Irrtum, das Vergehen ein jüdisch-christianisierter Sündenbegriff hineingelegt – das Fehlverhalten wird zur Sünde, so wie die Sünde später im verbürgerlichenden Mittelalter zum crimen wird, zum Verbrechen.
„Die Wahrheit tun“ (poiéo ten alétheian) heißt dann, „ans Licht kommen“, mit Gott zusammenstimmen. In die Wahrheit kommen, lässt sich auch benennen als Rückkehr in jenen Zustand der Unschuld zurück, in dem „alles gut ist“.
Dieser philosophischen Interpretation von Gott und Christus entspricht die Bedeutung des Wortes „Zeichen“ bei Johannes: Das semeíon meint sowohl das Wunder, welches etwas zeigt, wie auch jenes Zeichen, welches Beleg für eine Wahrheit ist. Da das Zeichen bei Johannes wichtig ist, ist es auch das Bezeichnen. Bei Johannes wird Jesus angeredet als Rabbi und Meister (Magister, der griechische didáskalos), als Rabbuni, und als Messias, der als christós graezisiert wird. Chríma oder Chrísma ist das Salböl und Christós entsprechend im neutestamentarischen Griechisch der Gesalbte, der (von Gott) mit dem Öl Bezeichnete.
Überhaupt ist im Rahmen der Bedeutung der Be-Zeichnung die ethnische Zugehörigkeit ein wichtiges Thema im Johannes-Evangelium. Jesus ist Galiläer, aber auch (im Sinne der „Religion“) Jude. Nathanael benennt er als alethós Israelítes, in dem kein Falsch ist (ho dólos ouk ésti, der keine Hinterlist, keinen Trug, keine Ränke hat).
Andererseits wundert sich die Samariterin am Brunnen, dass er sie um Wasser bitte, wo er doch ein Jude sei und sie (nur) eine Samariterin, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. (Joh. IV, 9) Jesus erwidert ihr: „denn das Heil (he sotería) kommt von den Juden.“ Sotería ist die Rettung, im Kontext des Neuen Testamentes am besten: die Erlösung. Das Heil kommt von den Juden, denn ihr Gott ist auch der von Jesus. Aus dieser Aussage werden entgegengesetzt, im Verlauf des Evangeliums „die Juden“, die Jesus töten wollen. In VII, 1: Danach zog Jesus in Galilea umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen deshalb, weil die Juden ihm nach dem Leben trachteten. (Joh. VII,1)
Schließlich wird die Frage wichtig, ob er „auch ein Galiläaer sei“, von den Pharisäern an Nikodemus gerichtet, jenen Pharisäer, der alleine sich aus Interesse mit Jesus unterhielt.
Im Anschluss an die Logospassage vom Anfang ist wichtiger aber das, was man abschütteln muss, um diesen Logos ganz freizusetzen: Ho sarx, das Fleisch. Für Johannes gibt es eine messerscharfe Trennung: Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was vom Geist (pneúma / spiritus) geboren ist, ist Geist. Des weiteren: Gott ist Geist, und die, die ihn verehren, müssen ihn im Geist und der Wahrheit verehren. Proskynéo, was hier mit verehren übersetzt ist, meint im Griechischen das körperliche sich Niederwerfen vor der Gottheit, also vor allem der Götterstatue, mit dem Kaiserkult insbesondere später in Byzanz als Proskynese auch das sich auf den Boden werfen vor dem Kaiser.
Schließlich dann: Der Geist ist es, der lebendig macht, (to pneúma), das Fleisch ist zu nichts nütze. (VI, 63). In der Interpretation verändert sich die jesuanische Botschaft, und die Interpretation geschieht durch eine klassisch griechische Sichtweise: Alles sinnlich wahrnehmbare, körperhafte ist vergänglich, ewig ist eine an Parmenides und Plato gemahnende „geistige“ Sphäre, die bei den Christen zu glauben ist, und die in Jesus kurz Leiblichkeit gewonnen hat.
Johannes formuliert diese Leib-Seele-Vorstellung als extremen Dualismus:
Ho philón tèn psychèn autoú apolései autén, kaì ho misón tèn psychèn autoú, en to kósmo toúto, eis zoèn aiónion phyláxei autén. (XII, 25)
Bios ist das Leben, psyché ist die Lebenskraft, der Ort der Leidenschaften, jeglichen Begehrens. Wer also am lebendigen Begehren hängt, wird es verlieren (mit dessen Tod). Miséo heißt hassen, verabscheuen, und letzteres ist das, worauf Johannes hinaus will. Alles lebendige Begehren ist zu verabscheuen, und damit bewahrt, bewacht (phylásso) derjenige sich das „ewige Leben“.
Der Tod des irdischen Lebens wird einem ewigen Geistleben gegenübergesetzt, so wie diese physische Welt (en to kósmo toúto) der jenseitigen gegenübersteht. Jesus ist die historische Wegscheide, denn „ich habe die Welt besiegt“ (egò neníkeka tón kósmos). Damit ist das irdische Leben des johannäischen Christen auf das „Absterben“ des Körpers aus, denn der Tod des Leibes befreit die Seele (pneuma), den Geist.
Man muss das ganz handfest sehen: Der Körper ist das Gefängnis des Geistes bzw. der christlich gedachten Seele. Der Tod ist darum für die, die nicht an die Auferstehung des Leibes glauben, und dazu musste man immer erst einmal einen erstaunlichen Realitätsverlust hingenommen haben, die „Erlösung“ der „Seele“ von dem Schmutz, mit dem sie ihre körperliche Hülle umgibt.
Egeria schreibt um 400 nach der Geburt des Herrn aus dem Heiligen Land von ihrer Pilgerfahrt zu den heiligen Stätten an ihre „Schwestern“ zu Hause, wohl in Galicias:
Und euch, meine Gebieterinnen und mein Licht, bitte ich, Euch meiner zu erinnern, gleichgültig, ob ich noch in meinem Körper gefangen oder schon davon befreit bin. (in: Heloise und ihre Schwestern. Hrsgg. von Feruccio Bertini. München 1991 (Rom 1989), S. 51 im Aufsatz von Franco Cardini: Egeria, die Pilgerin)
Nach Paulus, den drei synoptischen Evangelien und nach Johannes bedarf es nur noch der "philosophischen" Durchdringung der Materie durch die Kirchenväter, und das römische Christentum ist vollentwickelt vorhanden. In der Praxis wird zugleich eine massive Adaption an die römische Alltags-Wirklichkeit stattfinden. Eine Generation nach Paulus wird Tertullian vergeblich dagegen anschreiben, dass die Christen sich am heidnischen Amüsierbetrieb beteiligen. Sie werden, wo möglich, Sklaven halten, munter im Kriegsdienst töten, der weltlichen Macht in den Ämtern dienen, so sie ihnen eröffnet werden, nach Luxus und Reichtum gieren wie viele andere. Nicht alle, aber doch meist kaum verschieden von dem, was Johannes oder Paulus für „heidnisch“ gehalten hätten.
Was bleibt, sind die alten Texte und die wenigen, die sie lesen. Das Christentum der ersten hundert Jahre wird danach weithin verschwinden, aber die alten Texte werden ein Stachel sein, den immer wieder Einzelne denen, die sich weiter kurioserweise „Christen“ nennen, ins Fleisch drücken werden. Dieser Stachel, in einem sich wandelnden Umfeld, wird einer der Faktoren für die Einwurzelung des Kapitalismus im Abendland sein.
Wichtig scheint mir festzuhalten, dass der paulinische Jesus und der der Evangelien kein Religionsgründer in dem Sinne war, wie er wenige Generationen später dargestellt wird. Da nach seiner unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft alles ganz anders sein würde, entwickelt er weder einen neuen Kult noch eine neue "religiöse" Lehre, sondern reduziert unter hellenistischem Einfluss jüdische Vorstellungen auf eine um ihn und seinen Vatergott kreisende Erlösungsvorstellung: Er verkündet das Ende alles um Eigentum und soziale Bindungen kreisenden irdischen" Lebens, das Ende des Natur- und Kulturwesens Mensch und seiner Zivilisationen und einen nie dagewesenen Neuanfang für diejenigen, die ihm "folgen". Nach seinem Tod samt "Himmelfahrt" besteht die einzige Aufgabe für die, die ihm (nun nicht mehr seiner leibhaftigen Person) folgen wollen, darin, seine Wiederkunft zu erwarten und sich dabei von möglichst wenig "Irdischem" ablenken zu lassen (Eigentum, sexuelles Begehren, Gesetze, Staatsmacht).
"Religion" wird daraus erst, als seine Wiederkunft samt Erlösung ausbleibt. Da die entstehende Kirche damit ihre "Geschäftsgrundlage" verloren hat, schafft sie sich mit der Entwicklung von Religion eine neue: Die Kirche als Institution ersetzt das Himmelreich auf Erden (eine jüdische Zukunfts-Phantasie) durch die Erlösung in einem anderswo angesiedelten Jenseits und bekommt die Macht, mit ihren magischen Kräften Eintrittskarten für dieses Jenseits auszustellen. Unterwerfung unter die Kirche ist dafür die einzige Voraussetzung.
Übrigens: Der griechische Christos, was man vielleicht mit der Gesalbe oder der im Heil Stehende übersetzen könnte, taucht vielleicht zum ersten Mal in einem Text Jahrzehnte nach seinem Tod in einem (griechischen) Text von Flavius Josephus auf, der vielleicht sechs Jahre nach diesem Tod geboren wird, aber vielleicht auch erst viele Jahrhunderte später in einem christlichen Einschub in diesen Text. Manches spricht dafür, dass der kurze Einschub beim Juden-Römer Josephus nicht in den Kontext seiner übrigen Positionen in seinen 'Jüdischen Altertümern' passt. Zu Christus taucht dann später auch noch das Wort von den "Christen" auf. Laut Apostelgeschichte nennen bereits die Antiochener die Jesus-Anhänger spöttisch Christen, aber wohl diese nicht sich selbst so.
Da die Kirche - im Unterschied zu den römischen Vorstellungen - mit ihrem dem Judentum entlehnten Monotheismus sich nicht als ein Kult unter vielen versteht, sondern als alleiniger Besitzer der einzig wichtigen Wahrheit, tendiert sie zur monolithischen Unduldsamkeit, was sie in den Augen der Militär-Despoten des späten römischen Kaiserreiches attraktiv werden lässt - als sehr weltlich betrachtete Klammer für das zerfallende Reich. Da die Kirche zugleich in der lateinischen Welt nach und nach romanisiert wird, das heißt, dadurch an Einfluss gewinnt, dass ihre Gemeinden immer mehr aus braven römischen Untertanen besteht, die in vielem so leben wie ihre "heidnischen" Nachbarn, muss sie eine immer ausführlichere "Lehre" und eine Welt zunehmend magischer Rituale entwickeln, um sich selbst wenigstens von den Kulten um sie herum abzusetzen.
Zudem beruht ihr Erfolg darauf, dass in der Konkurrenz mit den anderen Kulten deren Verheißungen und deren Attraktivität möglichst übertroffen wird. Das leistet die entstehende neuartige Organisationsform der Kirche, die die Erlöserfunktion Jesu als christos/messias de facto auf sich selbst überträgt und dabei immer mehr institutionalisierte, recht weltliche Macht wenigstens für die ihr Untergebenen ausübt. Macht aber ist das Faszinosum für die Ohnmächtigen, die es sich durch Identifikation aneignen.
Religion als etwas völlig neuartiges nun erlaubt ein Leben, welches sich immer mehr von den Forderungen Jesu entfernt, wenn man denn nur zugleich seinen "Glauben" bekennt und an den magischen Ritualen der Kirche teilhat. Der Jesus der Evangelien (nicht der paulinische allerdings) richtete sein Angebot zum Apostolat vor allem an die "Sünder", also an Korrupte, an Verbrecher und Huren. Von ihm übernimmt die Kirche als sein Erbe die Funktion, zu bekehren und so der Erlösung zuzuführen. Als der Kirche Unterworfener kann man also zunehmend Sünder sein und doch bei Reue erlöst werden. Heiligkeit wird dabei zu einer seltenen Sonderform christlichen Daseins, welche die Kirche zunächst für sich beansprucht und dann als für den Christen üblicherweise unerreichbares Muster der Wenigen herausstellt.
Religion als etwas spezifisch christliches entwickelt so in bislang nie dagewesenem Maße eine Art Doppelmoral: Da ist einmal die vom Jesus des Paulus und der Evangelien geforderte Abkehr von der "Welt", die nun zur kirchlichen Lehre dazugehört, und eine von der Kirche mit ihrer Integration ins Imperium der Römer zugleich praktizierte und durchaus immer mehr bejahte tatsächliche Hinwendung zu genau dieser Welt, die so ganz anders ist als alles, was dem Jesus der frühen Texte vorschwebte.
Mein Interesse hier beruhte von Anfang darauf, dass der Kapitalismus in der "christlichen" Welt entsteht und sonst nirgendwo. Das von der Kirche durchgesetzte Christentum mit seiner Lehre, seiner Doppelmoral und der Ausbeutung eines zentralen Widerspruches wird die Einsetzung des Kapitalismus als Verweltlichung einer grundlegenden Widersprüchlichkeit einsetzen: Kapitalverwertung jenseits natürlicher Bedürfnisse, Arbeit jenseits derselben, Konsum als Ersatz für Lebendigkeit. Kapital als neuer Gott, der Erlösung von jedem Leid verheißt und dabei Leiden institutionalisiert. Nicht mehr die Kirche erlöst die Menschen nun von sich selbst durch Unterwerfung, sondern der Fortschritt, der alles und jeden unter die Verwertungszwänge des Kapitals drängt. Die Verheißung wird zunehmend, dass der dem Kapital unterworfene Mensch sich selbst von sich erlösen kann.
Die Seele und ihre Erlösung
Geist (pneuma/spiritus), Seele (psyche/anima) und Materie (hyle/materia) sind Eindeutschungen griechischer und lateinischer philosophischer Vorstellungen, deren ursprünglicher Problemgehalt längst nach philosophischer Schwerstarbeit in ihren bescheidendsten und mühelos auflesbaren Abfallprodukten so in die Sprache eingegangen ist, dass ihre Existenz als Selbstverständlichkeit gilt. Dass so recht niemand weiß, worum es sich dabei handelt, gehört dazu.
Seele:
Bei unserer ersten griechischen Quelle, bei Homer, taucht bereits die altgriechische Vorstellung einer psyché auf, die den Körper im Moment des Todes verlässt und in die Unterwelt abtaucht. Sie hat das Aussehen des Körpers, aber sie ist nur ein immaterieller Schatten von ihm, als welcher der tote Patroklos zum Beispiel seinem Freund/Geliebten Achilleus erscheint.
Christlichen Vorstellungen nähern wir uns dann mit den für den Hellenismus so einflussreichen Pythagoras-Anhängern, denen die Seele, nachdem sie den Körper verlassen hat, unsterblich bleibt. Das geht dann in einigen hellenischen Kreisen so weit, dass die von Schuld (noch nicht „Sünde“) gereinigte Seele in die Gefilde der Götter einzieht oder gar selbst göttlich wird. (Empedokles, Pindar).
Auf dem Weg ins Christentum wird aber vor allem der platonische Sokrates und die sich von ihm ableitende Schule der Kyniker wichtig. Sokrates fürchtet den Tod nicht, da er sich gewiss ist, dass ein besseres Leben folgen wird, weshalb das Seelenheil für ihn so wichtig ist. Seele und Geist scheinen dabei zusammenzufallen, denn dieses Seelenheil wird durch Erkenntnis vermittelt, für welche die Seele offenbar mit zuständig ist. In seiner Verteidigungsrede (Apologie), sagt Sokrates entsprechend:
Bester Mann, (…) schämst du dich nicht, für Geld zwar zu sorgen, wie du dessen aufs meiste erlangst, und für Ruhm und Ehre, für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele, dass sie sich aufs beste befinde, sorgst du nicht und hieran willst du nicht denken? (Ap.29)
Körper und Geist, oder Materie und Geist sind Pole, die nicht nur das Christentum zu immer neuem Nachdenken verführen werden. Sie decken sich des öfteren, wie bei Kreisen der Gnosis, mit den Polen Frau und Mann, oder denen von sexuellem Begehren und dem Ruhepol der Enkrateia, der Selbstbeherrschung, Keuschheit.
Die Trennung von Leib und Seele ist laut der ersten drei Evangelien zumindest nicht so sehr Jesu Sache. Bei Johannes wird Jesus auferstehen, indem sein Leib wieder dadurch lebt, dass er von der Psyche neu belebt wird. Er sagt dazu: So sehr liebt mich mein Vater, dass ich meine Seele (psyché) (gehen) lasse, auf dass ich sie wieder (zu mir) nehme. (Joh. X, 17). Er hat (X,18) von seinem "Vater" die Macht empfangen, sie herzugeben und wieder zurückzunehmen. Die Trennung, die Tod meint, ist also dank Gott nur eine vorübergehende. Aus solchen Vorstellungen kommt der urchristliche Glaube, dass dereinst Leib und Seele sich in der „Auferstehung“ hin ins ewige Leben wiedervereinen. Ähnlich wie bei den Juden resultiert daraus die Körperbestattung, die Ablehnung der Brandbestattung also, und die ewige Sakrosanktheit des Friedhofes, die bei den (frommen) Juden noch heute gilt.
Nicht ohne Einfluss auf die Entstehung des Christentums ist die Zerstörung des Tempels von Jerusalem, das Ende des klassischen Judentums mit dem Ende des Opferkultes und der Tempelpriesterschaft. Ähnlich wie schon vorher im Christentum gewinnen nun Lehre und Gebet an Bedeutung. Im sehr alten und nun an Bedeutung gewinnenden Achtzehnbitten-Gebet (Amida, Tefilla) taucht dann die jüdische Auferstehungslehre in der zweiten Bitte (Gebet) in neuer Orthodoxie auf:
Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr, belebst die Toten, du bist stark zum Helfen. Du ernährst die Lebenden mit Gnade, belebst die Toten in großem Erbarmen, stützest die Fallenden, heilst die Kranken, befreist die Gefesselten und hältst die Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist wie du, Herr der Allmacht, und wer gleichet dir, König, der du tötest und belebst und Heil aufsprießen lässt. Und treu bist du, die Toten wieder zu beleben. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Toten wieder belebst! (http://buber.de/cj/judaica/18bitten)
Ähnlich wie in Teilen des damaligen Judentums schreibt Paulus in beiden Korintherbriefen davon, dass die Auferstehung Jesu die leibliche Auferstehung aller Toten zur Zeit des „Jüngsten“ Gerichtes belege, worauf die bekannte Welt in das Reich Gottes übergehen würde. Der wesentliche Unterschied zwischen Judentum und Christentum besteht dabei ausschließlich in der Anerkennung Jesu als Christus, hebräisch: Messias, und in dem Verzicht auf die Ausschließlichkeit der Errettung einer (allerdings religiös begründeten) Volksgruppe.
Gerade aber eine von antiker Philosophie angereicherte Version des Christentums verlangt schon seit der Antike entweder für die Wiedervereinigung eine „reine“ Seele, oder aber sie formuliert die Erlösung/Auferstehung ohnehin nur für diese Seele, die in ihrer Reinheit immateriell ist wie die Gottesvorstellung.
Aus rein – unrein, leicht – schwer, hell – dunkel (Licht und Finsternis) ergibt sich ein besonders im Orient weitverbreiteter Dualismus, der immer noch fest im Unterbewussten der Menschen der „westlichen“ Welt, also des späten Kapitalismus, verhaftet ist und propagandistisch ausgenutzt wird. Danach kann nur die Seele rein sein, während der Körper von Exkrementen, Urin, Sexualsekreten und anderen Körperflüssigkeiten (Blut) verschmutzt, also unrein ist. Im Anschluss an die Ablehnung allen irdischen Begehrens (des Leibes?) wird aus diesen Reinheitsvorstellungen das mönchische Ideal entstehen, um als spätes Restfragment des Calivinismus/Puritanismus in Reinlichkeits- und Hygienewahn zu enden (jede Psychoanalyse von Goethetexten der ersten Hälfte seines Lebens wird das als eines seiner Kernthemen entdecken).
Die der Erlösung harrende christliche Seele ist möglichst rein, leicht und hell (licht). Ihre Leichtigkeit ergibt sich aus der Vorstellung ihrer Körperlosigkeit, wenn auch nicht unbedingt aus einer Immaterialität im Sinne des Materie-Begriffs der Antike. Im Anschluss an den göttlichen Atem, den Gott Adam einhaucht um ihn zu beleben (zu beseelen), wird die lateinisch-christliche Seele (anima) gerne nicht sehr gedankenvoll gleichgesetzt mit dem „Geist“, in den Evangelien pneuma, lateinisch dann später spiritus. Beide Wörter leiten sich von Hauch und Atem ab. Daher die alte Vorstellung, dass der Mensch sein Leben „aushauche“, die Seele also den Körper ganz handfest als letzten Atem verlässt.
Für die Masse der Christen wird der Seelenbegriff völlig unklar bleiben. Irgendwie ist sie der menschliche Kern, dem der unreine Leib als "Gefäß" dient, aber ist sie der Ort, von dem aus dieser Leib diszipliniert wird? Hat die Seele einen Willen, wo sie doch mit der Höllenvorstellung leidensfähig und der Himmelsvorstellung glücksfähig wird? Ist sie der mögliche Ort jenseits aller Triebhaftigkeit?
Nicht vorstellbar ist der christliche Seelenbegriff jedenfalls seit dem frühen Mittelalter ohne das christliche Gewissen, in dem die Gebote wie die dazugehörigen Strafbestimmungen im Idealfall völlig internalisiert sind, also nicht mehr weltlicher Strafandrohungen bedürfen - was außer bei wenigen Virtuosen der Heiligkeit allerdings nicht ganz funktionieren wird.
Ebenso ungenau ist die Neigung bis ins hohe Mittelalter, die Seele in die Nähe von Emotionen und Gefühlen (dem griechisch-antiken thymos) zu bringen, und in die Nähe des schon damals vorgestellten Ortes dafür, des Herzens. Unterscheidungen wie die augustinische zwischen mens, animus, anima sind für den üblichen Christen damals sowieso bereits eine Überforderung gewesen. Der Begriff der animal spirits im England des 18. Jahrhunderts, also jener belebenden Kräfte, wie sie sich in Lebendigkeit, Emotionalität ausdrücken (animal von animalis, belebt), ist ein Ausdruck der Schwierigkeiten, die schnell im Zusammenhang mit nicht unmittelbar sinnlich Wahrnehmbarem auftauchen.
Der Körper (Leib) ist also unrein, schwer, und er ist dunkel. Die reine Seele hingegen ist leicht und hell, und da es schon in den Evangelien heißt, dass Gott immer in sie hineinschauen kann, ist sie für ihn einsichtig und als reine Seele auch durchsichtig, ganz im Unterschied zum Körper, an dem vieles undurchsichtig ist, der Spekulation anheim gegeben, wie Vorgänge der Fortpflanzung oder die Funktionen der „Körpersäfte“, wie sie in der Humoraltheorie niedergelegt werden. Beim Säkular-Kalvinisten Jean-Jacques Rousseau ist dann die Seele nicht nur einsichtig, sie wird als reine Seele durchsichtig, kristallklar, wie er schreibt. Den Gefühlen einer diffusen, nicht verarbeiteten Schuld aus der Kindheit setzt er die Reinheit einer im Erwachsenendasein angeeigneten „natürlichen“ Unschuld entgegen, einer unschuldigen Natürlichkeit.
Aber zurück zur Blütezeit eines noch nicht völlig säkularisierten Christentums! Erlösung ist Reinigung, Erleichterung, Licht-Werden. Alles dies als Überwindung des Todes nach einer langen Wartezeit auf die Wiederkunft des „Herrn“ und nach einer Gerichtsverhandlung, im Mittelalter gerne auch als Abwiegen der guten und bösen Taten durch den Erzengel Michael dargestellt.

Dieses „Gericht“ passt nicht in die Jesus-Botschaft der ersten drei Evangelien und ist wohl ebenso nachträglich eingefügt wie die Form des Missionsauftrages und die Privilegierung des Petrus als Schlüsselbesitzer zum Himmelreich bzw. Paradies samt seiner Macht „zu binden und zu lösen“, was ihn zum Begründer der römischen Kirche machen soll.
In den Botschaften Jesu ist – zur Erinnerung – die Einladung ins „ewige Leben“, ins Himmelreich, ins Paradies damit verbunden, Schüler Jesu zu sein, ihm zu folgen, wobei das Sündenregister völlig irrelevant ist, ja, ganz im Gegenteil, der „Herr“ freut sich mehr über ausgemachte Sünder, die ihm folgen, als über „Gerechte“. Aber ohne die Bedrohung mit der/durch die Sündenlast wird die Mittlerrolle der Kirche, des Klerus und der Sakramente hinfällig, - genau das, was Häretiker seit dem Anfang des 11. Jahrhunderts formulieren.
Was meint diese leichte, lichte Erlösung in Reinheit in der Nähe Gottes? Sie ist in ganz später und sehr unphilosophischer Nachfolge jener griechischer Gedanken, wie sie am ausführlichsten von Plato überliefert sind, die Aufhebung aller irdischen Begrenzungen in ganz abstrakte Vorstellungen, deren einflussreichste wohl die von der Unendlichkeit wird, der Ewigkeit, jener des jüdischen Gottes wie der antiken Götter, die unsterblich sein sollen. Es ist, philosophisch gedacht, eine „Existenz“ in der Aufhebung von Raum und Zeit, im Absolutum, der Lösgelöstheit. Es ist andererseits, volkstümlich gedacht, die Rückkehr ins sehr irdische Paradies der Schöpfungsgeschichte, die Wiedervereinigung Gottes mit seiner Schöpfung, Wiederherstellung der Welt vor dem Sündenfall, vermittelt durch den Opfertod des Gottessohnes. Beide sehr verschiedene Vorstellungen werden durch das Mittelalter ungeniert nebeneinander existieren.
Da aber Gott nun einmal das Böse in seine Schöpfung eingebaut hatte, wird auch dieses weiterbestehen: Nach der Wiederkunft des Herrn wird die „Welt“ also fein säuberlich getrennt sein in Himmel und Hölle, ewiges Paradies und ewige Verdammnis. Fein säuberlich getrennt: Der besiegte Teufel wird in seiner Hölle eingesperrt sein, zusammen mit seinen Unterteufeln und all denen, die der ewigen Verdammnis anheim gefallen sind.

Was wir heute als großen christlichen Mythos beschreiben können, ist zumindest bis ins hohe Mittelalter - ausgenommen für wenige einzelne philosophisch Geschulte - handfest zu Glaubendes und mehr oder minder intensiv Geglaubtes. Dabei gab es für all diese keine Trennung zwischen Wissen und Glauben, was ihre Religion betraf. Die vorgegebenen Glaubensinhalte sollen vielmehr intensivste Gewissheit sein, soweit wir das heute erkennen können – oder sollten es zumindest sein. Häretiker sind nicht etwa ungläubiger, sondern intensiver an ihrem Glauben interessiert und weichen auch nicht von ihren biblischen Texten, sondern nur von spezifisch kirchlichen Positionen ab.
Erlösung:
Was heißt dabei Erlösung? Das Modell bietet Jesus in den Evangelien selbst: Es handelt von Tod und Auferstehung/Himmelfahrt, von Zerstörung und Wiederbelebung in einer anderen Qualität. An diesem Punkt fangen aber bereits die Schwierigkeiten an.
Die Geschichte in groben Zügen sollte noch heute bekannt sein: Jesus stirbt einen schlimmen Tod am Kreuz. Bei Matthäus, Markus und Lukas zerreißt bei seinem Tod der Vorhang des Tempels, dessen Macht dadurch wohl als gebrochen dargestellt wird. Lukas bietet zudem eine Sonnenfinsternis, Matthäus lässt noch die Erde beben und einige Gräber aufgehen, aus denen „Leiber von Heiligen aufstehen“. Das Ganze wirkt wie ein Vorgeschmack auf die apokalyptische Wiederkehr des Herrn.

Als nächstes entdecken zwei Marien, (Frauen!) das leere Grab, bei Johannes sind auch Petrus und Johannes dabei. Sie vermuten den Diebstahl der Leiche, denn sie kannten die Schrift noch nicht, die besagte, dass er von den Toten auferstehen. müsste. (Joh.) Schließlich sieht Maria Magdalena im Johannes-Evangelium den Auferstandenen: noli me tangere. Dann treffen ihn bei Lukas zwei bei Emmaus, die ihm von ihrer sehr traditionellen Erlösungsvorstellung reden: Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen (lytrousthai ton Israel). Er bricht das Brot mit ihnen und wird erkannt.
Auferstehung des Fleisches: Vom „noli me tangere“ geht es nun zur Berührung seines Körpers durch seine Jünger/Schüler. Bei Matthäus berühren zwei Marien seine Füße.
Bei Lukas fordert er seine Jünger auf: fühlt mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Bei Johannes erscheint der Auferstandene den elf Jüngern (Aposteln) und zeigt die von der Kreuzigung markierten Hände und Füße. Der ungläubiger Thomas darf die Wunden berühren.
Schließlich zeigt sich Jesus am Meer bei Tiberias, offenbart sich durch das Wunder des überreichen Fischfangs. Nur bei Markus fehlt dieser Aspekt: Er erscheint Maria Magdalena, aber: er offenbart sich unter einer anderen Gestalt.
Diese Geschichte von der Auferstehung des Fleisches wird beim Skeptiker Unglauben hervorrufen. Noch unwahrscheinlicher wirkt der darauf folgende Missionsauftrag des Auferstandenen. Bei Matthäus sagt er seinen Jüngern: Lehret alle Völker und taufet sie. Bei Johannes kommt es zum Auftrag an Petrus. Bei Markus fordert er auf, das Evangelium zu verbreiten.
Nicht sehr plausibel wirkt dieser Auftrag, weil laut Jesus selbst die Geschichte, am Ende die seinige, mit seinem Opfer-Tod zu Ende ist: Was mit Adam begann, wird mit Jesus enden. Der Missionsauftrag ist also so lange nach seinem Tod entwickelt worden, dass längst offensichtlich ist, dass die Geschichte doch weitergeht: Die Menschen müssen weiter auf Erden ihre Last tragen und werden weiter sündigen. Zugleich und dennoch werden die Christengemeinden und später die römische Kirche viele Jahrhunderte lang von diesem Weltenende reden. Noch in romanischen Kirchen werden Szenen der Apokalypse des Johannes und vom Richteramt Gottes („Jüngstes Gericht“) mahnend bis drohend abgebildet werden.

Den Schlusspunkt dieser Modellgeschichte von der Auferstehung des Fleisches bildet die Himmelfahrt: In der Vulgataversion des Markus heißt es: assumtus est in coelum et sedet a dextris Dei. (Er ist zum Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes.)
Entsprechend bei Lukas: ferebatur in coelum. Schließlich in der Apostelgeschichte fährt er in einer Wolke gen Himmel. Diese Acta Apostulorum berichten dann noch von Pfingsten und der apokalyptischen Verheißung und betonen: Sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Jesus als Christus überwindet den Tod, der Adams Strafe für den Sündenfall gewesen war und verspricht Unsterblichkeit.
Genau das wird die Botschaft der Kirche für die Christen: Die Seele wird sich wieder mit dem in seinem Grab ruhenden Körper verbinden und dann entweder in ewiger Seligkeit oder Verdammnis existieren. Im klassischen Pontifikal der Karolingerzeit befindet sich ein Gebet, welches der Priester bei der Einweihung eines Friedhofes spricht und in dem er Gott inständig anfleht, den dort ruhenden Körpern, die auf die Trompete des ersten Erzengels warten, den ewigen Trost zu gewähren. (Zitiert nach Audebert/Treffort, S.101)
Die Jesus-Geschichte enthält also eine Kernbotschaft und ein damit verbundenes Versprechen: Wer ihm folgt, wird erlöst werden. Ihm folgen heißt alle irdischen Bindungen aufgeben und sein radikales Liebesgebot einlösen. Erlöst werden heißt, von den Toten ganz körperlich wieder ins Leben zurückzukehren, allerdings in einer anderen, himmlischen Welt (oder doch auf Erden, nachdem dort der Gottessohn nach Wiederkunft die Herrschaft angetreten hat, und sei es nur für tausend Jahre?).
Allerdings wird sich das an Folgendem brechen: Je mehr Christen es geben wird, desto weniger von ihnen werden den wenigen und zugleich so radikalen Geboten ihres „Herrn“ folgen können und wollen.
Erlösung wovon? Für die meisten Laien bis ins Hochmittelalter, für die Bücher unzugänglich, und die leseunkundig sind, gibt es neben der Verpflichtung auf Sakramente, Kirchgang, neben der Predigt und der Unterrichtung durch Skulpturen und Gemälde nur zwei verpflichtende Texte, das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis (Credo).
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
- Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
- γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. (Matthäus)
Ähnlich wie die jüdische Version, das Kaddisch-Gebet, handelt es sich um Lobpreisung Gottes und Unterwerfung unter ihn. Ergänzt ist nur eine dreifache Bitte, um das tägliche Brot (um das Lebensnotwendige, nicht um Besitz), um Vergebung und um Erlösung – um Erlösung „von dem Bösen“. Letzteres klang sicher schon damals einladend, nur was es meint, bleibt hier offen – beim Beten mag jeder sich vorstellen, was er möchte. Wer sich allerdings bewusst ist, dass das in der Überlieferung des Matthäus-Evangeliums im Kontext der Bergpredigt steht, kann das Gebet im Sinne der Botschaft Jesu verstehen. Spätestens nach der Übernahme des weströmischen Reiches durch Germanen-Stämme ist dies aber bis zum Aufstieg der Stadtkultur im späten Mittelalter den meisten verborgen.
Zwei Formen der Erlösung: die im „kommenden Reich“ und die von der Sünde und vom „Bösen“, im Ergebnis wohl von der Schuldenlast in der himmlischen Kontoführung. Im „Paternoster“ bleibt all das aber im Unklaren.
Im Glaubensbekenntnis, dem „Credo“, wird die Erlösung ganz auf die Wiederkunft Christi konzentriert, auf das Gericht über die dann Lebenden und die vielen schon Toten: „Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein (sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.) Diese neue Welt am Ende des geoffenbarten Untergangs der alten wird den Zustand der Erlösung ausmachen: „Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.“ (Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi. Amen.)
Erlösung als Auferstehung und Bestehen beim Gericht mit der Konsequenz des ewigen Lebens in (Glück?)Seligkeit. Was da aufersteht, bleibt in diesen beiden christlichen Kerntexten offen: Ist es doch nur die Seele (psyché) oder mit ihr auch der Körper? Das moderne Lästermaul könnte zu letzterer Möglichkeit die Frage anschließen: Welcher Körper? Der im Augenblick des Todes? Der von den Würmern zerfressene? Der im Zustand eines Jünglings- und Jungfrauendaseins in voller Pracht? Wie viele Menschen haben sich das damals gefragt?
Eine frühe Antwort liefert die Vision der Perpetua von ihrem im Kinderalter verstorbenen Bruder:
Wenige Tage später, als wir gemeinsam beteten, kam mir plötzlich mitten im Gebet der Name Dinokrates auf die Lippen. Ich wurde stutzig, weil Dinokrates mir vorher niemals in den Sinn gekommen war, und die Erinnerung an sein Geschick betrübte mich. Ich erkannte, daß ich im Augenblick bei Gott in Huld stehe und für ihn beten müsse. So fing ich an, viel und unter Seufzen für ihn zum Herrn zu beten. Noch in derselben Nacht wurde mir dieses Gesicht gezeigt: Ich sah wie Dinokrates aus einem finsteren Ort hervorkam, an dem noch viele andere waren. Er war in Schweiß gebadet und hatte Durst. Sein Gesicht war schwarz und bleich, mit der Wunde bedeckt, an der er gestorben war. Das war leibhaftig mein Bruder Dinokrates, der mit sieben Jahren an einer Gesichtskrankheit elend umgekommen war, so dass sein Tod allen Menschen zum Ekel ward. Für ihn also hatte ich gebetet. Zwischen ihm und mir war jedoch ein großer Abgrund, so daß wir beide nicht zusammenkommen konnten. An dem Ort aber, an dem Dinokrates stand, war ein Brunnen, voll von Wasser. Doch der Brunnenrand ragte hoch über das Haupt des Jungen hinaus. Dinokrates reckte sich, als wollte er trinken. Er tat mir leid; obgleich der Brunnen ganz voll war, konnte Dinokrates nicht an das Wasser herankommen und trinken. Da wurde ich wach und erkannte, daß mein Bruder in Not war. Aber ich hoffte zuversichtlich, ihm in seiner Not beistehen zu können, und betete für ihn alle Tage, bis wir ins Militärgefängnis überführt wurden. Wir sollten nämlich bei den Kasernenspielen zum Geburtstag des Cäsars Geta kämpfen. Ich betete also für Dinokrates Tag und Nacht unter Seufzen und Tränen, damit er mir geschenkt würde.
An dem Tage, an dem wir in den Block gespannt waren, hatte ich folgendes Gesicht: Ich schaute an jenem Ort, den ich schon früher gesehen hatte, Dinokrates, frisch gewaschen, gut gekleidet und wohlauf; an der Stelle, an der vorher die Wunde war, sah ich eine Narbe. Auch bemerkte ich, wie jenes Wasserbecken, das ich beim erstenmal gesehen hatte, jetzt einen niedrigeren Rand hatte, der nur noch bis zum Nabel des Knaben reichte. Aus dem Brunnen strömte unaufhörlich Wasser, eine goldene Schale voll Wasser stand auf seinem Rande. Dinokrates trat hinzu und trank aus der Schale. Die Schale aber wurde nicht leer. Als sein Durst gelöscht war, ging er daran, fröhlich mit dem Wasser zu spielen - ganz nach Kinderart. Dann wurde ich wach und erkannte, daß Dinokrates von seiner Qual erlöst war. (7/8)
In seiner 'Vita sua' beschäftigt das Anfang des 12. Jahrhunderts Gilbert (Guibert) von Nogent im Zusammenhang mit Betrachtungen über die körperliche Schönheit seiner Mutter:
Man sagt auch, dass unsere Körper, einmal unter die Auserwählten eingereiht, nach der Pracht des Körpers Christi gestaltet werden, und zwar so, dass die Hässlichkeit, durch einen Unfall oder durch natürliche Verwesung zugezogen, verbessert wird, wenn wir übereinstimmen mit dem auf dem Berge transfigurierten Sohn Gottes. (Ad hoc etiam nostra electorum corpora corporis claritati Christi configuranda dicuntur, ut foeditas, quae casu seu naturali corruptione contrahitur, ad regulam transfigurati in monte Dei Filii corrigitur. (Guibert, S.14)
Beide Erlösungsvorstellungen ziehen sich durch die Zeit bis ins hohe Mittelalter. Vorstellungen von einer Seele reichen auf der einen Seite von einer untrennbar mit dem Körper verbundenen Seele bis zu einer, die völlig von ihm getrennt gedacht werden kann.
Die griechische Version der jüdischen Seelenvorstellung (meist neschama oder nefesch) in der Septuaginta, der Koine-griechischen Übersetzung der jüdischen „Bibel“ für die hellenisierten Exiljuden vor allem in Alexandria viele Generationen vor Jesus, bezeichnet die Seele als psyché. Das klassische Judentum tendierte aber dazu, Körper und „Seele“ als Einheit aufzufassen, das hebräische Wort für Seele bezeichnete den Atem. In der Schöpfungsgeschichte bläst Gott dem aus der Erde geformten Wesen seinen Atem durch die Nase ein, wodurch er zu Adam, dem Menschen wird.
In der jüdischen Version der Paradiesgeschichte fehlen Seele und Erlösung. Die wohl wichtigste Ebene dieser Geschichte setzt zwei Phänomene in eine notwendige Beziehung zueinander: Erkenntnis und Tod. Adam und Eva waren unsterbliche Ebenbilder Gottes, bis sie nach Erkenntnis strebten, die des Teufels war. Was kann da mit Erkenntnis anderes gemeint sein, als jene Entwicklung von Bewusstsein, die diese Menschen von allem um sie herum abtrennte, in Differenz zu allem brachte, was ihr nun als Objekte entgegentrat? Und was macht diese Differenz gravierender als die zu sich selbst – in der das Subjekt Mensch sich selbst als Objekt entgegentritt? Und schließlich: Was objektivierte den Menschen stärker als das Wissen um den eigenen Tod? Es ist eine moderne Interpretation.
Die Folgen sind bekannt: Der sterbliche Mensch bedarf der sexuellen Gier, um sich fortzupflanzen (und nicht auszusterben), und er bedarf der produktiven Arbeit, um sich ernähren zu können. Das Paradies einer unerkannten Welt bleibt ihm von nun an verschlossen.
Tatsächlich ist diese Vorstellung als Wunschvorstellung aber durch die Menschheitsgeschichte gegeistert, denn Wissen bedarf zugleich der Lüge, um erträglich zu bleiben, jedenfalls für die meisten. Schon in steinzeitlichen Gräbern (und nur Menschen begraben ihresgleichen und sogar Tiere) finden sich Grabbeigaben, die nur Sinn machen, wenn man an eine Form des Weiterlebens glaubt, in der solche mehr oder minder nützlichen Dinge Verwendung finden.
Da es oft die wertvollsten Besitztümer des Toten sind, die so unter die Erde geraten, lassen sich Wurzeln eines Kapitalismus naturgemäß erst dann entdecken, als dieser Brauch aufgegeben wird. Bereits im römischen Reich wurde eher in die Qualität des Sarkophages oder das Grabgebäude investiert, und das frühe Christentum neigte dazu, nichts zur Leiche dazu zu geben, da der Mensch ohne irdische Besitztümer auferstehen würde. Das lässt sich natürlich auch anders sehen: Die beweglichen Besitztümer des Toten verschwanden nicht mehr unter der Erde, sondern wurden als Erbe weitergegeben, konnten so der Anhäufung von Kapital dienen – was sie in der Regel zunächst einmal nicht taten.
Das Wirkliche, das Eigentliche und der Tod
Bewusstsein ist Ursache und Symptom von Entzweiung, es beinhaltet sowohl Wissen wie zugleich Vermeidungsstrategien gegenüber demselben. Das Wissen um den Tod führt zur Vorstellung von Ewigkeit, das Wissen um die Subjektivität aller Wahrnehmung führt zur Vorstellung einer alles übertreffenden Wahrheit, das Wissen um die unvorstellbar große Vielfalt führt zur Vorstellung von Einheit, Einssein, dem Einen überhaupt, in dem alles sich finden soll.
Das Wissen um Leid und Schmerz führt zu Erlösungsvorstellungen. Diese haben im als Religion auftretenden jüdischen Nationalmythos eine durchaus sehr irdische Komponente, die mit der Loslösung des Christentums vom Judentum für ersteres zunächst verloren geht: Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Danach wäre Erlösung Aufhebung des spezifisch Menschlichen durch den Menschen selbst, seine Rückführung ins Paradies, Abwerfen der Last der Kultur und Rückkehr in eine paradiesisch gedachte Natur, bzw. die Umwandlung der wirklichen Natur in eine eigentliche, den Garten des jüdischen Gottes.
Vor allem aber wäre Erlösung die Erlösung des Menschen von sich selbst, seine Rückführung aus dem Reich der falschen Welt in das der Eigentlichkeit. Das aber ist viel eher eine griechische als eine jüdische Vorstellung. Es ist die durch Plato vor allem bekannte, in der das Wirkliche, also sinnlich wahrnehmbar Wirkende, nur ein schlechtes Abbild (eidolon) des eigentlich Wahren und darum eben nicht sinnlich Wahrnehmbaren ist.
Für das Studium der Entstehung des Kapitalismus im christlichen Abendland wird dieser Aspekt eines Kultes des Eigentlichen wichtig werden: Jesus ruft dazu auf, alles das abzuwerfen, was das wirkliche Leben vom eigentlichen trennt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“
Um es deutlich zu machen: Zum eigentlichen Leben gelangt man über den Tod, den Opfertod Jesu und danach den eigenen. Der Tod öffnet die Pforte zur Eigentlichkeit, das wirkliche Leben und Lebendige hingegen gehört dem „Fürsten dieser Welt“, dem anheimzufallen ewige Höllenqualen bedeutet. Die Abwertung des Wirklichen gegenüber dem Eigentlichen ist bei Sokrates/Plato noch eine graduelle, mit Jesus und dem Christentum wird sie eine substantielle.
Solange die Wiederkunft Christi noch handfest ins Haus stand, blieb es dabei. Sobald diese immer weniger in das alltägliche Bewusstsein Eingang findet, gilt es, sich in einer Welt einzurichten, die laut Religion und Kirche des Teufels ist. Die Überwindung dieser Welt schon in dieser Welt wird die Phantasie werden, mit der Menschen den Kapitalismus ans Laufen bringen werden: Die Welt und alles Lebendige wird zu einem durch Technik überwindbaren Problem. Wie viel oder besser wenig ihnen dabei davon bewusst war, ist eine andere Frage.
Kulturen können Menschen ihr Leben ohne Erlösungsvorstellungen leben lassen, ganz bestimmte entwickeln aber offensichtlich einen Bedarf danach: Wie virulent der christliche Erlösungsgedanke bleibt, zeigen Rousseaus wahnhafte Vorstellungen und nach dem Absterben des Christentums im spät-entfalteten Kapitalismus die kommunistische Paradiesversion von Marx/Engels & Co., nunmehr der platonischen Substanz zur Gänze beraubt: Nicht Raum und Zeit werden mehr aufgehoben, die Menschen haben inzwischen auf Erden das Potential zur Erlösung, indem sie sich einer neuen apokalyptischen Geschichte anschließen.
Dabei wird die Paradiesgeschichte auf den Kopf gestellt: Der Sündenfall als Menschwerdungsgeschichte wird bejaht und die Natur dieses sündigen Menschen wird in idealistische Phantasien von „Natürlichkeit“ eingebunden. Zudem haben Marx/Engels & Co die jüdische/christliche Erlösungsreligion durch eine Geschichtsphilosophie ersetzt, die Religionsersatz bietet.
Der verlorene Sohn
Die Entstehung des Kapitalismus ist eine abendländische Besonderheit. Es ist, und das ist das Phänomenale, eine Sache ganz spezifisch des „christlichen“ Abendlandes und keines anderen Raumes der Erde. Ein auf den ersten Blick unglaubliches Phänomen ist das, weil die evangelische Botschaft eine Aufforderung zum Ablassen von allem Begehren ist außer dem hin zum „Himmelreich“, dem Reich des „Vaters“. Jede Form von übriger Begehrlichkeit ist Sünde und des Teufels, ein Laster, wie es später im Deutschen heißen wird. Wie aber anders als vermittelt durch vielfältige Formen von Gier hätte der Kapitalismus entstehen können? Ist er nicht am Ende die Befreiung des Lasterhaften von allen Schranken, allen Beschränkungen, aller Form von Sittlichkeit? Kapitalismus ist in der modernen Vollversion die schrankenlose Verwertung von Kapital zwecks Vermehrung desselben und nichts anderes geworden. Die Beschränkungen, die der säkulare Staat noch setzt, sind allesamt diesem Kapitalverwertungsziel unterworfen, sieht sich der moderne Staat selbst doch diesem Ziel unterworfen.
Insbesondere im Lukas-Evangelium mit seinen Besonderheiten, aber im Kern überall im Neuen Testament gibt es eine zweite Botschaft, die sich gegen die gesetzestreue Rechtschaffenheit wendet, insbesondere gegen die „Pharisäer und Schriftgelehrten“, wie Luther sie übersetzt. In meiner Übersetzung: „Es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut (hamartolo metanoousti), vor neunundneunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen.“
Hier, im Gleichnis vom „verlorenen Schaf“, ruft Jesus nicht zum Sündigen auf, aber er wendet sich (Lukas 15, 1/2) gegen besagte „Pharisäer und Schriftgelehrte“, die genau dasselbe vertreten wie danach zweitausend Jahre lang fast alle Christen und ihre nicht christlichen Nachbarn: Sündern gehört nicht vergeben, sie gehören bestraft oder zumindest verachtet.
Die zentrale evangelisch-jesuanische Auffassung besagt, dass Nächstenliebe wichtiger sei als Gesetzestreue, wobei Jesus bejaht, den (säkularen) Gesetzen der römischen Machthaber zu entsprechen, nicht aber um jeden Preis den religiösen des jüdischen Tempels.
Ihr Potential zur Ablehnung des sich in ersten Ansätzen erst über tausend Jahre später ankündigenden Kapitalismus (Kapitalverwertung als Quasi-Naturgesetz) erhält diese Position dann durch die Wendung gegen Besitz und gegen das Klammern an „irdische“, materielle Werte. Bei Lukas lautet das entsprechende Jesuswort so: Jeder unter euch, der nicht auf alles verzichtet, was er besitzt, kann nicht mein Jünger sein. Im für das Mittelalter so wichtigen Latein der Vulgata-Bibel heißt das: „Sic ergo omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus.“
Der „Jünger“ der Lutherbibel ist im mittelalterlichen Latein der „Schüler“, genauso wie im griechischen Original (mathetés). Gemeint ist jeder, der von Jesus lernen möchte, im griechischen Original tritt Jesus als Lehrer auf, und wird als solcher auch angesprochen, als „Rabbi“, ein hebräisches Wort. Dies aber nur am Rande, geht es hier doch darum, dass Jesus von seinen Anhängern – und nicht nur hier und bei Lukas – strikte Besitzlosigkeit verlangt. Und die Begründung, die ganz in seine Lehre hineinpasst, lautet im Vulgata-Latein des Lukasevangeliums so: Non potestis Deo servire et mammonae. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen. (Lk 16, 13).
Man muss dazu wissen, dass man sich im antiken Judentum auf der Basis einer gewissen Schriftgelehrtheit aus eigenen Stücken als Rabbiner betätigen konnte, aber dabei außer üblicherweise zur Schriftgelehrsamkeit zur Besitzlosigkeit und zur Unentgeltlichkeit der Arbeit als Rabbi verpflichtet ist. Und Jesus erweist sich in den Evangelien als Kenner einiger alttestamentarischer Schriften, auf die er immer wieder einmal verweist; schließlich lebt er, „auf dass die Schrift erfüllt würde.“ Gemeint ist damit natürlich im Kern, dass der Sündenfall Adams durch Jesus (als Christus spätestens) wieder aufgehoben würde - für die, die ihm folgen, seine Schüler, d.h. bei Luther „Jünger“ sind.
Bis tief in die romanische Architektur hinein wird sehr häufig dann das abgebildet werden, was bei Lukas folgt: die Geschichte vom armen Lazarus und vom reichen Mann.

Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren.
Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham, und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir; er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer.
Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden.Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer und unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte.
Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters!Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen.
Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
Ersterer wird nämlich nach seinem Tod von den Engeln in „Abrahams Schoß“ getragen, d.h. in jüdischer Bildersprache in den (christlichen) Himmel. Der Reiche kommt bei Lukas selbstverständlich in die Hölle mit ihren Qualen, ohne dass das näher erklärt werden muss.
Ähnlich wie der Buddhismus ist das evangelische Christentum extrem ungeeignet, um als Rechtfertigung für die Entstehung eines Kapitalismus zu dienen. Ganz im Gegenteil scheint die Botschaft Jesu, das „Evangelium“ also, ein extrem solides Bollwerk gegen auch nur die geringsten Wurzeln oder Keime für das zu sein, was wir seit über 150 Jahren als Kapitalismus bezeichnen. Bis in das sogenannte Hochmittelalter hinein, bis – stilgeschichtlich betrachtet – hin zur Wendezeit zwischen Romanik und Gotik sind diese Grundpositionen der Botschaft Jesu auch im Abendland allgegenwärtig, in den Kirchen mit ihren Skulpturen und Wandmalereien, den Predigten, und in den Texten der wenigen Schriftgelehrten.
Zwei weitere Texte aus dem Neuen Testament verstärken diese Positionen noch: Die Lukas-Geschichte vom verlorenen Sohn und die von Matthäus über die Arbeiter im Weinberg. Bevor auf beide eingegangen wird, und danach dann sehr vorläufig auf die Frage, warum ausgerechnet im christlichen Abendland, und zu einer bestimmten Zeit, die Wende hin zum Kapitalismus stattfinden kann, und zwar offenbar unaufhaltsam, sei auf einen literarischen Aspekt dieser evangelischen Texte eingegangen, denn diese Texte sind natürlich alle Literatur, von Menschen geschrieben.
Seit dem 18. Jahrhundert werden solche Geschichten Jesu, Erzählungen von ihm, im Deutschen gerne als Gleichnisse bezeichnet, in jüngerer Zeit manche von ihnen auch als Parabeln. Jesus spricht (in den Evangelien) manchmal sehr deutliche oder sogar sehr harte Worte, wie hier oben erwähnt bei Lukas über die Unverträglichkeit von Besitz und Jesus-Lehre, härter noch vor allem bei Matthäus. Aber in zahlreichen Fällen verdeutlicht er seine Lehre durch erfundene Beispiel-Erzählungen, in denen er an sehr alltäglichen Beispielen verdeutlicht, was er meint; wenn zum Beispiel das eine verlorene Schaf (oder der eine verlorene Groschen, Drachme natürlich damals in dieser hellenistischen Weltgegend), so wiedergefunden, viel mehr Freude bereitet als die nicht abhanden gekommenen vielen.
Oft benennt Jesus danach selbst die Lehre, die aus der Geschichte zu ziehen ist. Manchmal, wie in der Geschichte vom verlorenen (und wiedergefundenen) Sohn löst er sein Gleichnis nicht so ganz auf und lässt den Leser oder Zuhörer zunächst etwas baff zurück.
Wichtig an solchen gleichnishaften Geschichten ist, dass sowohl die dem Alltag entnommene Geschichte selbst wie auch die lehrhafte Quintessenz plausibel sein sollen (und müssen!). Es macht darum wenig Sinn, in der Art neuzeitlicher Interpretationskünstler die alltägliche oder die religiöse Substanz wegzudiskutieren in der Art eines „es war ja nicht ganz so gemeint“, eben um Christ bleiben zu können, ohne Jesu Botschaft ernstnehmen zu müssen. Das mag den Aggregatzuständen eines immer dünner werdenden Christentums entsprechen, hilft aber nicht, Spätantike und Mittelalter uns Heutigen verständlich zu machen.
Bis ins Hochmittelalter fand dieses Wegdiskutieren auch nicht statt, und bis ans Ende des später Mittelalter genannten Zeitabschnitts wurde es nicht grundsätzlich betrieben, sondern nur jeweils am einzelnen Gegenstand, an dem die Lehre Jesu zu relativieren war (Musterbeispiel dafür ist das Sich Herumwinden um das Zinsverbot des Evangeliums).
Nun also zunächst einmal zur Geschichte vom verlorenen Sohn, die, da die Bibel heutzutage weitgehend unbekannt ist, hier noch einmal zitiert werden soll nach Lukas XV, 11, 32:
Er (Jesus) sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater: „Vater, gib mir den mir zustehenden Teil des Vermögens!“ Und er teilte das Vermögen unter ihnen auf. Und nicht lange darnach, als er alles zu Geld gemacht hatte, zog der jüngere Sohn fort in ein fernes Land; und dort verschleuderte er sein Gut, indem er in Saus und Braus lebte.
Als er alles ausgegeben hatte, kam eine schwere Hungersnot über das ganze Land, und er begann Mangel zu leiden. Und er ging hin und verdingte sich bei einem Bürger jenes Landes, und der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte sich zu sättigen von den Trebern (Johannisbrotschoten), die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon.
Da ging er in sich und sprach: „Wieviele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.‘“
Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Da sprach der Sohn zu ihm: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.“
Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: „Schnell, holt das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und feiern, denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und wurde gefunden.“ Und sie begannen zu feiern.
Der ältere Sohn war aber auf dem Felde. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er die Musik und den Tanz, und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das bedeute. Der aber sprach zu ihm: „Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund zurück bekommen hat.“ Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn.
Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe niemals ein Gebot von dir übertreten, und nie hast du mir einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Als aber dieser, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, kam, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet.“ Er aber sprach zu ihm: „Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Man muss aber feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren und wurde wieder gefunden.“
Die Geschichte dreht sich um drei Dinge: Sünde – Barmherzigkeit – Gerechtigkeit. Der jüngere Sohn ist der Sünder; er verprasst sein Erbe mit Huren, gibt sich mit kultisch unreinen Schweinen ab, ist also aus dem Judentum herausgetreten. Der Vater, mit dem Jesus seinen himmlischen Vater meint, ist der Barmherzige, der nicht einmal ein Bekenntnis der Reue verlangt, sondern den zurückkehrenden Sünder mit offenen Armen aufnimmt, und der Gerechte ist der ältere Sohn, der alles richtig macht und zusehen muss, wie nicht er, sondern sein sündiger Bruder gefeiert wird.
Ein beunruhigender Text für Christen, die sich natürlich in aller Regel schon in der späten Antike nicht mehr an diese Botschaft gehalten haben, so sie denn Respekt vor der Haltung des „Vaters“ verlangt, die Gnade vor Recht ergehen lässt, um es etwas lax auszudrücken.
Völlig verstören müsste Christen, dass die Barmherzigkeit des Vaters so bedingungslos ist, dass sie nicht einmal Reue verlangt, Reue gegenüber dem Verrat am (kultischen) Judentum und seinem Gott und Reue gegenüber der Verschleuderung des väterlichen Erbes in der Fremde. Der Vater nimmt den Sohn in vollen Ehren zurück, bevor dieser seinen vorher mit Geschick vorformulierten Spruch loswerden kann, der ein Sündenbekenntnis und eine Unterwerfungsgeste enthält, aber kaum der Vorstellung von einem reuigen Sünder entspricht. Man gewinnt auch den Eindruck, der Vater ignoriere diesen Spruch seines Sohnes.
Tatsächlich ignoriert er auch die Erklärung des älteren Sohnes, der sich um den väterlichen Haushalt und die (jüdische) Religion verdient gemacht hat, im Sinne des Vaters nichts falsch gemacht hat, und dem der Vater nur vorhält, dass sein selbstverständliches Verhalten nicht der Erwähnung geschweige denn einer Festivität würdig sei.
Es machte keinen Sinn, die Geschichte zugunsten ihrer gleichnishaften „religiösen“ Essenz abzuwerten, um sich so aus der Tatsache zu stehlen, dass das väterliche Verhalten nach allen menschlichen Vorstellungen ungerecht ist. Es nützt also nichts, sich darauf herauszureden, die Geschichte sei – was ihre erzählte alltägliche Substanz angehe – nicht so ernst zu nehmen, denn dann würde sie als Gleichnis nur wenig taugen. Darüber hinaus soll die religiöse Essenz ja genau durch das Erzählte verdeutlicht und verständlich gemacht werden.
Wir haben keinen einzigen Bericht darüber, wie die Laienwelt bis ins Hochmittelalter hinein im Einzelnen mit dieser Geschichte umgeht, die sowohl dem rechtlichen Rahmen ihrer Lebenswelt diametral widerspricht, der durch die Beziehung von Schuld und Strafe geprägt ist, wie auch den wirtschaftlichen Gegebenheiten zu allen Zeiten. Mit dem väterlichen Verhalten, dass beim älteren Sohn nur Trotz, Zorn und Verbitterung hervorrufen kann, ist kein Landgut, kein Bauernhof zu betreiben, wie er in der Geschichte vorkommt, und es wird schon gar nicht möglich, Keimzellen eines Kapitalismus herauszubilden.

Anfang des 16. Jahrhunderts stellt eine Firma Tapisserien, Wandteppiche her, die genau diese Geschichte „malerisch“ darstellen. Sie werden im Armenhospiz in der burgundischen Stadt Beaune an den Wänden aufgehängt und sie haben ein unübersehbares, großes Format. Beaune ist in dieser Zeit bereits vom Königreich Frankreich annektiert und erlebt weiter eine kontinuierliche Blütezeit in Handwerk, Weinbau und Handel. Viele Aspekte eines frühen Kapitalismus sind hier bereits weithin ausgeprägt vorhanden.
Um zu erklären, wie die bildliche Veröffentlichung des Gleichnisses mit diesen frühkapitalistischen Strukturen zusammengeht, lässt sich zum einen sagen, dass im Hochmittelalter in den Städten jener Umbruch stattfindet, der religiöse Inhalte und alltägliche Wirklichkeit immer mehr trennt, wofür als Kunststil dann die Gotik entsteht. Zum anderen, dass in einer wohltätigen Stiftung wie dem christlich fundierten und von Nonnen betriebenen Hospiz inselartig christliche Vorstellungen weiterleben, die außerhalb von Kloster und Kirche völlig anderen Vorstellungen gewichen waren.
Dennoch: Die Teppiche waren öffentlich aufgehängt und aufgrund ihrer außergewöhnlich guten handwerklichen bzw. künstlerischen Ausfertigung wohl der Stolz der ganzen Stadt.
Es wird davon zu reden sein, dass sich im 12./13. Jahrhundert eine Trennung zwischen säkularer und hergebracht christlicher Welt vollzieht.
Nun noch ein weiteres „Gleichnis“, welches mindestens genauso stark alle die Werte und Vorstellungen ablehnt, auf denen der Kapitalismus von Anfang an basiert. Es ist die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, und man kann sie bei Matthäus 20,1-16 nachlesen. Sie beginnt mit der Erklärung von Jesus an Petrus, dass derjenige das ewige Leben erhalten werde, der Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Wein und Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlässt. (Mt 19, 20) Und das vertieft er dann mit folgender Geschichte:
Das Himmelreich gleicht einem Menschen, einem Hausherrn, der hinausging gleich am Morgen, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern auf einen Denar als Tageslohn übereingekommen war, schickte er sie in seinen Weinberg. Und als er den Weinberg um die dritte Stunde verließ, sah er andere auf dem Markt untätig stehen, und jenen sagte er: „Geht auch ihr in den Weinberg, und was gerecht ist, werde ich euch geben.“ Und sie gingen hin. Wiederum hinausgegangen um die sechste und neunte Stunde, tat er genauso.
Um die elfte Stunde hinausgegangen, fand er andere stehen und sagt ihnen: „Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig?“ Sie sagen ihm: „Niemand hat uns angeworben.“ Er sagt ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg.“ Als es aber Abend geworden war, sagt der Herr des Weinbergs seinem Verwalter: „Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn, beginnend bei den Letzten bis zu den Ersten.“ Und es kamen die um die elfte Stunde und erhielten je einen Denar. Und es kamen die ersten und meinten, dass sie mehr erhielten. Und es erhielten je einen Denar auch sie. Nachdem sie (ihn) erhalten hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten: „Diese Letzten arbeiteten eine (einzige) Stunde, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben.“
Er aber antwortete einem von ihnen und sprach: „Freund, ich tue dir kein Unrecht; bist du nicht auf einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit dem, was mir gehört, zu tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse,weil ich gut bin?“So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Der Spruch von den Ersten und Letzten dient vermutlich durch das ganze christliche Abendland hindurch auch als Trost und Beruhigungsmittel für die, die es auf Erden schwer haben und dafür den Lohn „im nächsten Leben“ zugesprochen bekommen – im Unterschied zu „den Reichen“, die es kaum bis ins Himmelreich schaffen würden (weil sie zu sehr an irdischem Besitz hängen, um Jesus nachfolgen zu können).
Die theologische Quintessenz hieß natürlich durch die Geschichte des christlichen Abendlandes hindurch, dass irdische (menschliche) und himmlische (göttliche) Gerechtigkeit nichts miteinander gemein haben. Die Geschichte aber, wieder die eines Gutsbesitzers und seines Landgutes, beschreibt eine Gerechtigkeit, die jedermann im Alltag, vielleicht von wenigen Heiligen abgesehen, eher für eine flagrante Ungerechtigkeit halten würde. Die Faulenzer, die von sich aus nicht arbeiten wollen und nur kurze Zeit arbeiten, werden genauso entlohnt wie die braven Fleißigen.
Plausibel wird die Umwertung aller (bestehenden und naturgegebenen) Werte, wenn man – jenseits des Mittelalters - in der Immanenz der evangelischen Geschichte ausharrt. Jesus kündigt seine nahe Wiederkunft an, den Zusammenbruch alles irdisch Bestehenden und die Aufkunft eines neuen „Reiches“ (Gottes). Auf dieser Grundlage ist die Abkehr von allen Regeln, die ein Landgut aufrecht erhalten, das einen Markt beschicken kann, naheliegend: Wozu sich noch um Irdisches kümmern, wo das Himmelreich nahe ist.
Hundert Jahre nach Jesus stellen sich die Christengemeinden bereits darauf ein, dass die Erlösung der wenigen „Auserwählten“ offenbar doch in weiterer Ferne liegt. Wenn jener Papst Gregor, den sie den Großen nennen werden, und noch mehr sein Zeitgenosse, der gleichnamige Bischof von Tours, in einer Zeit, als die Franken über Gallien herrschen und Germanen über England und große Teile Italiens und Spaniens, von dieser Endzeit schreiben, ist diese zwar einerseits in ihrem Wortlaut gewiss und bevorstehend, aber sie agieren nicht mehr so, als sie sich um ihre jeweiligen Bistümer und eben auch ganz intensiv deren weltliche Belange kümmern.
Historiker haben in den letzten Jahrhunderten die Mär verkündet, dass beim Herankommen des ersten Millenniums die Menschen in Angst und Schrecken um ein apokalyptisches Ende gewesen seien. Davon kann wohl keine Rede sein. Ein derart aufgeregtes und panisches Christentum entwickelt sich erst viel später auf der Basis jener Entwurzelungen, die Menschen mit dem frühen Kapitalismus verbunden sehen, im übrigen gleichzeitig mit Hexenverfolgungen und Religionskriegen.
Die Apokalypse (Offenbarung) des „Johannes“ feiert mit ihren Darstellungen in Kirchen und Klöstern im (sog.) Hochmittelalter eine Renaissance. Tatsächlich werden damit aber gemeinhin keine nahen Endzeiterwartungen mehr verbunden, vielmehr tritt sie im Rahmen des allgemeinen romanischen Skulpturenrepertoires auf, in dem die Angst, der Schrecken und das Grauen, alles urmenschliche Gegebenheiten, elementare Bedeutung haben. Religiös werden sie in die Vorstellungen vom „Jüngsten Gericht“ integriert, in denen es für die wenigen die Auferstehung in die Gemeinschaft mit Gott im „Himmelreich“ gibt und für die vielen (vom König über den Bischof bis zum Mönch, dem Bauern und dem Handwerker und Händler) die Höllenqualen - ebenfalls in eternitate.
Die jesuanische Botschaft in ihrer ganzen Radikalität, ja Subversität verliert mit der ausbleibenden Wiederkunft des Erlösers ihre Plausibilität. Dennoch bleibt sie bis ins Mittelalter, bis in die Wurzelzeiten des Kapitalismus fast omnipräsent. Mir drängt sich bei Betrachtung dieses Phänomens immer stärker der Verdacht auf, dass dies der Grundwiderspruch ist, aus dem die unendliche Widersprüchlichkeit des Kapitalismus entstand, jener naturvernichtenden, lebensfeindlichen und menschenverachtenden Absurdität, die die Abhängigkeit von der Natur durch die von einer zweiten, menschengemachten Pseudonatur ersetzen will, getrieben nicht von Menschenfreundlichkeit, von einem Annehmlicher-Machen der Welt, sondern von schierer Gier, die längst alle Schranken zu überschreiten bereit ist.
Nur ist das bis hierhin nichts als eine Vermutung. Mit den allerdings sehr unzulänglichen Mitteln der Psychoanalyse gilt es auch zu verfolgen, wie sich dabei der Verzicht auf Emotionalität und Triebhaftigkeit, wie ihn die Religion fordert, überträgt in jenen Verzicht, der Kapitalbildung fördert und die Umformung von lebendiger Natur in tote Waren – wenn man denn dieser Vermutung folgt. Das heißt dann, es gilt, Verbindungen zwischen den inneren Triebkräften des Menschen und ihrem Umgang damit einerseits und dem äußeren Vorgang des Wirtschaftens herzustellen.
Dies dann allerdings, ohne dass der heutige Mensch in seiner inneren und äußeren Ausgestaltung als eine Art anthropologische Konstante gesetzt und der Vergangenheit übergestülpt wird.
 Eine ferne, fremde Welt
Ursprünge des Kapitalismus im Mittelalter
Eine ferne, fremde Welt
Ursprünge des Kapitalismus im Mittelalter